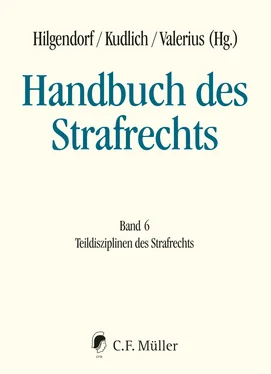a) Einschränkung der Fahrlässigkeitsverantwortlichkeit durch den Vertrauensgrundsatz
85
Allgemein anerkannt ist seit der Entscheidung der Vereinigten Großen Senate im Jahre 1954[528] die sorgfaltspflichtbegrenzende Wirkung des Vertrauensgrundsatzes im Straßenverkehr, nach dem jeder grundsätzlich auf verkehrsgerechtes Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer vertrauen darf; er muss mithin sein Verhalten nicht darauf einrichten, dass andere sich ordnungswidrig oder unvernünftig verhalten.[529] Dies leitet sich aus dem Gesichtspunkt fehlender unzulässiger Gefahrschaffung infolge erlaubten Risikos her[530] und soll verhindern, dass bei der Bestimmung der eigenen Handlungsweise Sorgfaltspflichtverletzungen anderer stets einzukalkulieren wären.[531] Der Anwendungsbereich des Vertrauensgrundsatzesblieb aber nicht auf das Verhalten im Straßenverkehr beschränkt, sondern führt überall dort zu einer Begrenzung der Sorgfaltsanforderungen, wo gefahrträchtige Handlungen arbeitsteilig vorgenommen werden.[532] Müsste jeder alles Kontrollierbare kontrollieren, so wäre Arbeitsteilung nicht möglich. Stattdessen hat jeder an einem arbeitsteiligen Geschehen Beteiligte nur bestimmte, in seinem Verantwortungsbereich liegende Umstände zu überwachen.[533] Einen wesentlichen Anwendungsfall stellt die ärztliche Heilbehandlung dar,[534] bei der – je nach fehlender oder gegebener Weisungsberechtigung und Weisungsgebundenheit – zwischen horizontaler und vertikaler Arbeitsteilung zu unterscheiden ist. Für beide Fallgestaltungen gilt, dass im Falle der Arbeitsteilung jeder Beteiligte in seinem Zuständigkeitsbereich in eigener Verantwortung tätig ist (Eigenverantwortungsprinzip).[535] Auf dessen Vorgehen lege artis dürfen sich die übrigen am Behandlungsprozess Beteiligten von Rechts wegen grundsätzlich verlassen, da andernfalls (also bei einer unbegrenzten allseitigen Überprüfungs- und Kontrollpflicht) die mit der Arbeitsteilung verbundenen, patientennützlichen Vorteile nicht zu erreichen wären.[536] Ohne den Vertrauensgrundsatz wäre arbeitsteiliges Zusammenwirken nicht zumutbar, da es mit dem Risiko verbunden wäre, unabhängig von persönlichem Fehlverhalten für die Sorgfaltswidrigkeit eines anderen[537] zur Verantwortung gezogen zu werden.[538] Liegen aber Umstände vor, aus denen erkennbar wird, dass ein an der Krankenbehandlung Mitbeteiligter seinen Aufgaben nicht gewachsen ist, so tritt an die Stelle des zuschreibungshindernden Selbstverantwortungsprinzips das – unabhängig von der jeweiligen Fachkompetenz bestehende – Prinzip ärztlicher Gesamtverantwortung für den Patienten. Dieses gebietet, den Patienten vor Schäden zu bewahren, die aus offenkundigen Fehlleistungen eines anderen am Behandlungsprozess Beteiligten (Arzt oder Pflegepersonal) resultieren.[539] Die umfassende Gesamtverantwortung greift umso eher ein, je größer das Risiko eines Behandlungsfehlers und die daraus resultierende Gefährdung des Patienten ist.[540] Letzteres gilt insbesondere für die Mitwirkung von krankenpflegerisch ungeschulten, zuhause behandelten Patienten oder bei deren Versorgung durch Angehörige.[541]
86
Des Weiteren trifft die am Behandlungsprozess beteiligten Ärzte die Verpflichtung, Risiken zu minimieren, die sich gerade aus dem Zusammenwirken verschiedener Fachrichtungen ergeben. Diese Koordinierungspflichtgilt insbesondere bei Unverträglichkeit der jeweils verwendeten Methoden oder Instrumente,[542] bspw. dann, wenn bei einer Augenoperation die Anästhesie als Ketanest-Narkose (Zuführung von reinem Sauerstoff in hoher Konzentration) verabreicht wird und der Operateur zum Stillen von Blutungen einen Thermokauter einsetzt, mit dem verletzte Gefäße durch Erhitzung verschlossen werden. Hierbei war es zu einer heftigen Flammenentwicklung gekommen, bei der die Patientin schwere und entstellende Verbrennungen im Gesicht erlitten hatte.[543] Hier rügte der 6. Zivilsenat zurecht, dass „die beteiligten Ärzte sich allein auf die Regelung des eigenen Verantwortungsbereichs beschränkt hätten, ohne untereinander die erforderliche Koordination und Absprache vorzunehmen.“[544]
b) Grenzen des Vertrauensgrundsatzes
aa) Erkennbares Fehlverhalten Dritter
87
Keine strafbarkeitseinschränkende Wirkung entfaltet der Vertrauensgrundsatz dann, wenn dem Vertrauen auf richtiges Verhalten anderer erkennbar die Grundlage entzogenist. Dies ist bspw. im Bereich des Straßenverkehrs dann der Fall, wenn für den Täter das verkehrswidrige Verhalten oder die Verkehrsuntüchtigkeit eines anderen Verkehrsteilnehmers deutlich erkennbar ist.[545] Diese Konstellation, in der das grundsätzlich schutzwürdige Vertrauen in sorgfaltsgemäßes Verhalten Dritter infolge konkreter Verdachtsmomente erschüttert ist,[546] kommt in dem Bereich arbeitsteiliger Patientenbehandlung eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu; ein Beispiel aus der Rechtspraxis:[547] Zwar darf ein nur für die Durchführung der Operation (Testovarektomie, d.h. die Entfernung einer Zwitterdrüse, die die Funktion von Eierstock und Hoden vereint) hinzugezogener Chirurg darauf vertrauen, dass der zuweisende Arzt (Direktor einer medizinischen Universitätsklinik) die Operationsindikation zutreffend gestellt hat. Dies gilt aber dann nicht mehr, wenn sich intraoperativ ein Befund (hier: normale weibliche Anatomie) ergibt, der ihm Anlass geben muss, an der Richtigkeit der Indikation zu zweifeln.[548] In den deutlichen Worten des für die Arzthaftung zuständigen 6. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs: „Für einen vergleichbaren Sachverhalt hat der Senat (…) zu den Anforderungen an einen Hausarzt entschieden, dieser dürfe sich zwar im Allgemeinen darauf verlassen, dass die Klinikärzte seine Patienten richtig behandelt und beraten haben, und dürfe meist auch auf deren bessere Sachkunde und größere Erfahrung vertrauen. Anders sei es aber dann, wenn der Hausarzt ohne besondere weitere Untersuchungen auf Grund der bei ihm vorauszusetzenden Kenntnisse und Erfahrungen erkennt oder erkennen müsse, dass ernste Zweifel an der Richtigkeit der Krankenhausbehandlung und der dort seinen Patienten gegebenen ärztlichen Ratschläge bestehen. … Kein Arzt, der es besser weiß, darf (…) sehenden Auges eine Gefährdung seines Patienten hinnehmen, wenn ein anderer Arzt seiner Ansicht nach etwas falsch gemacht hat oder er jedenfalls den dringenden Verdacht haben muss, es könne ein Fehler vorgekommen sein. Das gebietet der Schutz des dem Arzt anvertrauten Patienten.“[549]
bb) Eigenes „verkehrswidriges“ Verhalten
88
Eine weitere Einschränkung soll der Vertrauensgrundsatz dadurch erfahren, dass sich auf ihn nicht berufen kann, wer sich selbst „verkehrswidrig“verhält.[550] Mit dieser Formulierung sind zwei sachlich verschiedene Aussagen verbunden:[551] Zum einen bezeichnet sie eine Ausnahme vom Vertrauensgrundsatz für die Fälle, in denen verkehrswidriges Verhalten der Erwartung sachgerechten Handelns anderer die Grundlage entzieht, weil es Fehlreaktionen zu provozieren geeignet ist oder solche bereits erkennbar sind. Wer andere durch verkehrswidriges Verhalten in eine gefährliche Lage bringt, darf sich nicht darauf verlassen, dass diese die von ihm heraufbeschworenen Gefahren meistern werden. Zum anderen wird mit der Formulierung lediglich die Konsequenz aus der nur sorgfaltspflichtbegrenzenden Funktion des Vertrauensgrundsatzes gezogen. Sie enthält dann die an sich selbstverständliche Aussage, dass im Vertrauen auf sorgfältiges Handeln anderer nicht sorgfaltswidrig gehandelt werden darf:[552] So kann ein die Medikation anweisender Krankenhausarzt sich nicht dadurch entlasten, dass seine offenkundige Fehl-Anweisung von der Stationsschwester bei gehöriger Aufmerksamkeit unschwer hätte erkannt und hierdurch der Tod des Patienten hätte verhindert werden können. Dies bedeutet freilich nicht, dass der sorgfaltswidrig Handelnde auch für solche Folgen seines Verhaltens einstehen muss, die erst durch das Hinzutreten fremder, nach dem Vertrauensgrundsatz außer Betracht zu lassender Sorgfaltswidrigkeiten eintreten. In Abwandlung des eben genannten Beispiels: Der Patient erlitt eine schwere Gewebeschädigung, da die intravenös zu setzende Spritze anweisungswidrig von einer Lernschwester verabreicht und paravenös gesetzt wurde; für diese Nekrose war die vom Stationsarzt angeordnete Fehl-Medikation unerheblich. Würde man demgegenüber allein aus einer Sorgfaltspflichtverletzung pauschal einen Ausschluss des Vertrauensgrundsatzes herleiten wollen, so liefe dieses Überspielen sonst gültiger Zurechnungsvoraussetzungen auf eine unzulässige Sanktionierung eines versari in re illicita als Reaktion auf eine nicht erfolgsrelevante Sorgfaltspflichtverletzung hinaus.[553]
Читать дальше