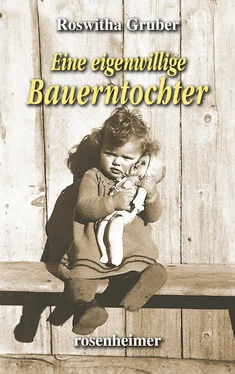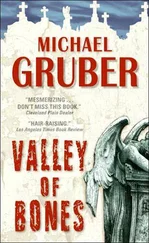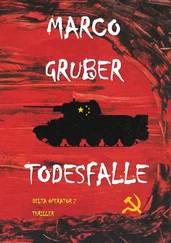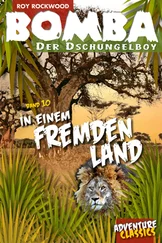Nun hielt ich es für nötig, ihn zu belehren: »Doch, darin besteht ein bedeutender Unterschied. Die Bäuerin wusste ja nicht, wer die Eier genommen hat. Deshalb hat sie mich verdächtigt, eine Eierdiebin zu sein.«
»O, das tut mir leid. Auf die Idee, dass sie dich im Verdacht haben könnte, kam ich gar nicht. Hast du deshalb etwa Schwierigkeiten gekriegt?«
»Und ob! Sie hat mich ganz offen des Eierdiebstahls bezichtigt. Seitdem sieht sie mich misstrauisch an, und ich fürchte, sie wird mir am Ende des Monats meinen Lohn kürzen, um sich schadlos zu halten.«
Zerknirscht fragte er: »Was kann ich tun, damit sie ihre Meinung ändert?«
»Auf der Stelle gehst du zu ihr und gestehst, dass du der Täter bist. Nur damit kannst du mich reinwaschen. Danach gebe ich dir deine Schuhe zurück. Dann benötige ich sie ja nicht mehr als Beweisstücke.«
Bei der Bäuerin muss er umgehend ein ausführliches Geständnis abgelegt haben. Denn bei unserer nächsten Begegnung zwinkerte sie mir zu: »Da warst du ja ganz schön gescheit!«
Ende Juli schlug die Abschiedsstunde für unseren Feriengast. Bevor der Bauer ihn zur Bahn brachte, überreichte Giselher mir einen selbstgepflückten Feldblumenstrauß und raunte mir zu: »Der Abschied von dir fällt mir sehr schwer. Aber sobald ich daheim bin, werde ich dir schreiben.«
»Die Mühe kannst du dir sparen, ich kann nämlich nicht lesen.«
»Haha! Wieso habe ich dich dann manchmal in einen Roman vertieft in einer Ecke angetroffen?«
»Gut beobachtet, Sherlock Holmes!«, lobte ich ihn. Die Herrin hatte mir tatsächlich erlaubt, mich in meiner Freizeit an ihrem Bücherschrank zu bedienen. Dafür, dass sie eine Bäuerin war, war er beachtlich bestückt.
Für die Blumen bedankte ich mich artig bei meinem Ritter und gab sie in eine Vase. Diese stellte ich aber nicht in meine Kammer, sondern mitten auf den Küchentisch, damit sich alle daran erfreuen konnten.
Als in den folgenden Wochen kein Brief von meinem Verehrer eintraf, war ich doch einigermaßen enttäuscht. So sind halt die Mannsbilder, dachte ich, machen einem die tollsten Versprechungen und dann vergessen sie einen nach dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn. Doch bald schon hatte ich ihn ebenfalls vergessen.
Am 1. September 1939 trat ein Ereignis ein, das viele Millionen Menschen ins Verderben stürzen sollte. Der Krieg, der an diesem Tag in Polen, weit weg von uns, angefangen hatte, erschütterte auch bald unsere kleine Hausgemeinschaft. Bereits nach wenigen Wochen wurde nicht nur der junge Bauer eingezogen, sondern auch sein Rossknecht und sein Schweineknecht. Nur Albert, der Großknecht, durfte bleiben, weil er für den Kriegseinsatz schon zu alt war. Vor seinem Abmarsch legte der Jungbauer die volle Verantwortung in Alberts Hände. Fortan war es seine Aufgabe, die Arbeit einzuteilen und darüber zu wachen, dass der Betrieb reibungslos lief. Das war aber nicht einfach mit nur zwei Männern auf dem Hof, die zudem nicht mehr die Jüngsten waren. Der Großknecht selbst hatte die Fünfzig längst überschritten, und der Altbauer ging stark auf die Siebzig zu. Deshalb sprach Albert bald bei der Ortskommandantur vor und stellte einen Antrag auf männliche Hilfspersonen. Für die drei Männer, die man vom Hof abgezogen hatte, versprach man ihm drei polnische Zwangsarbeiter. Diese sollten aber nicht bei uns im Haus schlafen, sondern in einem Nebengebäude. Deshalb beauftragte mich die Jungbäuerin vor deren Ankunft, dort die Betten zu beziehen, die sich in zwei Kammern befanden, sowie die Böden und die Fenster zu putzen. Diesen Aufgaben kam ich bereitwillig nach, es waren ja keine ungewohnten Arbeiten, die sie von mir verlangte. Nachdem die Polen eingetroffen waren, gehörte es zu meinen täglichen Pflichten, ihre Betten zu machen, aufzuräumen, abzustauben und die Böden sauber zu halten. Einer von ihnen hatte wohl ein Auge auf mich geworfen und spitzgekriegt, wann ich diese Arbeiten zu erledigen pflegte. Deshalb ging er eines Tages nicht zur Arbeit. Welche Ausrede er dem Großknecht aufgetischt hatte, weiß ich nicht. Er versteckte sich unter seinem Bett und wartete, bis ich kam. Während ich seine Kissen aufschüttelte, kroch er plötzlich hervor und richtete sich in voller Größe vor mir auf. Einige Sekunden war ich starr vor Schreck. Diese nutzte er, um seine Arme um mich zu schlingen und mich zu küssen. Vielleicht wollte er auch mehr. Plötzlich löste sich meine Erstarrung und ich schlug ihm mit meiner freien Hand voll ins Gesicht. Verdutzt über meine Gegenwehr lockerte er seinen Griff etwas. Dadurch gelang es mir, mich aus seiner Umklammerung zu befreien und die Flucht zu ergreifen. Aufgeregt rannte ich zur Bäuerin und platzte heraus: »Im Nebengebäude werde ich keine Betten mehr machen!«
»Ja, warum denn nicht?«, fragte sie erstaunt.
Völlig außer Atem schilderte ich ihr, was vorgefallen war.
Sie reagierte völlig vernünftig: »Diesen Mann und auch die beiden anderen werden wir genau beobachten, damit solche Übergriffe nicht mehr vorkommen. Du machst die Zimmer nur noch, wenn wir sicher wissen, dass sie weit vom Haus entfernt beschäftigt sind.«
Ende Februar 1940 suchte die Herrin mit mir ein Gespräch unter vier Augen. »Ursula«, begann sie, »dein Pflichtjahr geht bald zu Ende. Hast du schon Ziele oder Pläne für die Zeit danach?«
»Nein«, musste ich gestehen. »Bis jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich werden will. Ich weiß nur gewiss, was ich auf keinen Fall werden möchte, nämlich Bäuerin.«
»Das kann ich gar nicht verstehen, dass dir dieser Beruf so zuwider ist. Für mich selbst ist es der schönste Beruf, den es gibt.«
»Bei mir ist es gerade umgekehrt, ich kann mir keinen schrecklicheren Beruf vorstellen. Deshalb bin ich froh und dankbar, dass ich bei euch nicht in den Kuhstall musste.«
»Was ist denn an einem Kuhstall so schlimm?«, hakte sie nach.
»Kühe sind mir nicht geheuer. Nicht nur vor ihren langen, spitzen Hörnern habe ich Angst, sondern auch vor ihren Hufen, mit denen sie einem ganz schöne Tritte versetzen können.«
Sofie lachte: »Anscheinend hast du daheim schon Bekanntschaft damit gemacht.«
»Und ob! Mehr als einmal. Wenn eine schlecht gelaunt war, hat sie mich mitsamt dem halbvollen Milcheimer vom Schemel getreten.«
»Wenn ich dir verspreche, dass du auch weiterhin nicht in den Kuhstall musst, und wenn du also sonst noch nichts vorhast, würdest du dann ein weiteres Jahr bei uns bleiben? Du weißt ja, es ist Krieg, der verlangt uns allen viel ab. Deshalb wäre ich froh, wenn du bleiben würdest. Gewiss, mir würde ein neues Mädchen zugewiesen, das müsste ich aber erst mühsam anlernen. Wenn du bleibst, wäre das eine Erleichterung für mich.«
Für meine Antwort benötigte ich nur wenige Sekunden Bedenkzeit: »Warum eigentlich nicht? Mir gefällt es bei euch. Ihr seid alle sehr nett. Vielleicht kommt mir in diesem zusätzlichen Jahr endlich die Erleuchtung, welchen Beruf ich wählen soll. Bevor ich aber endgültig Ja sage, brauche ich die Zustimmung meiner Eltern.«
Diese bekam ich postwendend. Meine Mutter begrüßte es ausdrücklich, dass ich noch ein Jahr bleiben wollte. Brigitte aber würde uns Ende März verlassen. Ihr, dem Stadtmädchen, war es hier auf die Dauer zu ländlich. Außerdem – oder gerade deswegen – litt sie ständig unter Heimweh. Am 1. April trat an ihre Stelle ein neues Mädchen, die Doris aus Landshut, sie war 14 Jahre alt. Mit ihr verstand ich mich ebenfalls gut. Sie bezog das frei gewordene Bett in unserer Kammer. Von Brigitte übernahm sie die Aufgabe als Kindsmagd. Als solche war sie jedoch noch weniger ausgelastet als ihre Vorgängerin, denn die Kinder waren im Laufe des Jahres wesentlich selbstständiger geworden und bedurften nicht dauernd der Aufsicht. Deshalb wurde Doris auch im Kuhstall eingesetzt, was ihr ausgesprochen Spaß machte, obwohl sie ein Stadtmädchen war.
Читать дальше