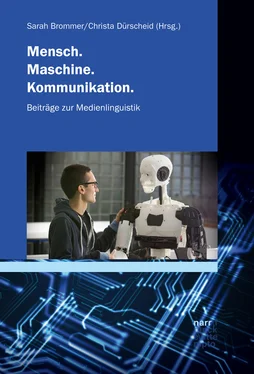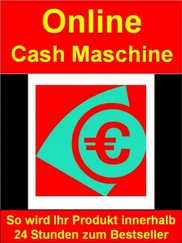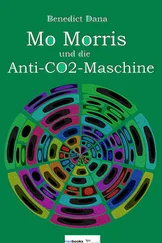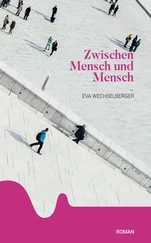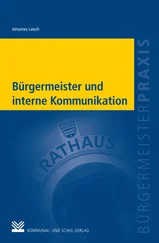Halten wir fest: Je stärker die Faktoren in die eine oder andere Richtung ausgeprägt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dies auf den sprachlichen Duktus auswirkt. Grundsätzlich gilt: Je ‹synchronerKommunikationsynchrone›, desto spontaner, sprachlich weniger reflektiert und weniger geplant (vgl. Dürscheid 2003: 11).
TechnischTechnik gesehen erlaubt es WhatsApp WhatsApp, mit Gesprächsteilnehmenden sowohl quasi-synchronKommunikationquasi-synchrone wie auch asynchronKommunikationasynchrone zu kommunizieren. Wenn beide (oder mehrere) Gesprächsteilnehmende die AppApp und die entsprechende Konversation gleichzeitig geöffnet haben, kommunizieren sie quasi-synchronKommunikationquasi-synchrone. Die Gesprächsteilnehmenden können solch eine quasi-synchrone KommunikationKommunikationquasi-synchrone an der entsprechenden Anzeige identifizieren: Produziert der oder die Kommunikationspartner*in gerade einen Beitrag, wird vom System darüber informiert. Dabei unterscheidet WhatsApp auch zwischen den Medialitäten. So kann es sein, dass es heisst, xy «schreibt» gerade oder dass aktuell eine «Tonaufnahme läuft». Push-NachrichtenMedium/Medien1 in WhatsApp ermöglichen es, Beiträge unmittelbar nach dem Absenden zu rezipieren und darauf zu antworten. Dies ist auch dann der Fall, wenn die oder der Rezipient*in die App nicht geöffnet hat. Charakteristisch ist weiter, dass für die Gesprächspartner*innen nicht nur ersichtlich ist, ob eine Nachricht rezipiert wurde,2 sondern auch deutlich wird, ob die angeschriebene Person die App geöffnet hat («online» ist). Dieser Faktor erhöht die soziale KontrolleKontrolle: Man könnte unter Rechtfertigungsdruck geraten, weil man Nachrichten zur Kenntnis genommen hat, jedoch nicht darauf reagiert. Daraus lässt sich die Vermutung ableiten, dass über WhatsApp ‹synchronerKommunikationsynchrone› kommuniziert wird als über andere Instant-MessagingInstant-Messanging-Dienste.
Allerdings zeichnet sich WhatsApp WhatsApp auch durch Merkmale der asynchronen KommunikationKommunikationasynchrone aus. Denn wendet man die drei oben genannten Faktoren ‹Überarbeitbarkeit›, ‹Parallelität› und ‹Wiederverwertbarkeit› auf WhatsApp an, wird deutlich, dass technischTechnik gesehen all dies umstandslos möglich ist: Beiträge können redigiert werden, ehe sie versendet werden.3 Es ist auch möglich, «gleichzeitig» mehrere Konversationen zu bedienen, d.h. schnell zwischen den «Chats» hin- und herzuwechseln. Auf Nachrichten kann später einfach zurückgegriffen werden, indem nach oben gescrollt oder im Suchfeld ein Suchbegriff eingegeben wird. Alle Konversationen werden protokolliert.
Ähnlich wie WhatsApp WhatsApp informiert iMessage iMessage darüber, ob der oder die Konversationspartner*in gerade einen schriftlichen Beitrag produziert. Wird ein mündlicher Beitrag (eine Audiodatei) produziert, wird dies allerdings nicht angezeigt. Im Unterschied zu WhatsApp zeigt iMessage zudem weder an, ob die andere Person «online» ist oder wann sie die AppApp zuletzt geöffnet hat, noch ob sie die Nachricht gelesen hat. Zwar lässt sich einstellen, dass eine Lesebestätigung angezeigt wird, dies gehört aber nicht zur Default-Einstellung. Angezeigt wird jedoch, ob eine Nachricht dem oder der Empfänger*in zugestellt worden ist.
In Bezug auf die drei von Dennis/Valacich genannten Faktoren zur Ermittlung des Grades an SynchronizitätKommunikationsynchrone lassen sich dieselben Aussagen wie bei WhatsApp WhatsApp treffen: Die Beiträge sind – vor dem Absenden, aber nach der ersten Produktion – überarbeitbar. Mehrere Konversationen können gleichzeitig geführt werden, und schriftliche Beiträge sind im Nachhinein über die Suchfunktion oder durch Scrollen abrufbar. TechnischTechnik gesehen lässt iMessage iMessage demzufolge denselben Grad an SynchronizitätKommunikationsynchrone zu, wie dies bei WhatsApp der Fall ist. Weil jedoch nicht angezeigt wird, wann der oder die Gesprächspartner*in zuletzt online war, besteht ein wesentlicher Unterschied hinsichtlich der sozialen KontrolleKontrolle.
Obwohl es unterschiedliche E-MailE-Mail-Messaging-Dienste gibt, unterscheiden sie sich technischTechnik nicht wesentlich voneinander. E-Mails werden klassischerweise zur asynchronen KommunikationsformKommunikationasynchrone gezählt. Im Jahr 2007 verweist Thaler auf E-Mails als Extrembeispiel asynchronerKommunikationasynchrone, computervermittelter Kommunikation. Sie spricht von einer «fehlenden Geschwindigkeit des Feedbacks, welche durch die technische Infrastruktur der Kommunikationsform E-Mail bedingt ist» (Thaler 2007: 171), denn es sei keine spontane Übernahme der Produzent*innenrolle möglich (vgl. ebd.). Im Jahr 2020 müssen diese Begründungen kritisch betrachtet und die Rahmenbedingungen der E-Mail-Kommunikation neu beurteilt werden. Die Geschwindigkeit des Feedbacks wird durch die Möglichkeit, E-Mails auch mobil – d.h. unterwegs – zu lesen und zu beantworten, stark erhöht. Hinzu kommt: Wer Push-Nachrichten für E-Mails aktiviert hat, kann diese genauso schnell rezipieren, wie dies bei WhatsApp WhatsApp- und iMessage iMessage-Nachrichten der Fall ist. Es ist, wiederum wie bei den beiden anderen Diensten, zudem auch nicht mehr notwendig, den Kommunikationskanal für Produktion oder Rezeption der Nachrichten jedes Mal aufs Neue zu öffnen (sofern eine funktionierende Internetverbindung vorhanden ist). Im Unterschied zu WhatsApp und iMessage weiss der oder die Verfasser*in eines Beitrages in der Regel aber nicht, ob die angeschriebene Person die Mail gelesen hat, wann sie zuletzt online war und ob die Nachricht überhaupt zugestellt worden ist.1 Vielleicht sind gerade deswegen bei längeren Abwesenheiten automatisch generierte Nachrichten üblich geworden, in denen darüber informiert wird, wann man wieder erreichbar ist.
Eine interessante, E-MailE-Mail-spezifische Möglichkeit ist die Planung des Sendezeitpunktes, die es erlaubt, individuell eine Zeitspanne zwischen Produktion und Versenden einer Mail zu definieren. Diese Möglichkeit kann zur AsynchronieKommunikationasynchrone beitragen. Allerdings ist es keine Default-Einstellung, dass nach dem Zeitpunkt gefragt wird, wann eine Mail versendet werden soll. Es ist eher üblich, zwischen dem Abschluss der Produktion und dem Versenden keine Zeitspanne einzuplanen.
Die technischenTechnik Voraussetzungen für die Geschwindigkeit des Feedbacks (und damit den Grad an SynchronizitätKommunikationsynchrone) sind bei E-MailE-Mails demzufolge zwar nicht identisch mit iMessage iMessage und WhatsApp WhatsApp, aber dennoch vergleichbar. Es ist rein technischTechnik gesehen genauso möglich, in Sekundenschnelle Nachrichten hin- und herzuschicken. Dazu muss der Kanal nicht jedes Mal neu geöffnet, sich nicht jedes Mal neu eingeloggt werden. Und ähnlich wie bei den anderen beiden Messaging-Diensten gilt: Bevor eine Nachricht verschickt wird, kann sie problemlos überarbeitet werden; auch eine ‹Parallelität› mehrerer Konversationen ist möglich. Der Faktor der ‹Wiederverwertbarkeit› ist besonders stark ausgeprägt. Weil E-Mails meistens mit einer Betreff-Zeile ausgestattet sind, sind Beiträge im Nachhinein noch leichter abrufbar als bei den anderen beiden Diensten. Dazu kommt, dass Mails als Favoriten markiert werden können, wodurch wichtigere Inhalte noch schneller wiedergefunden werden können. Im Sinne von Dennis/Valacich (1999) tragen diese Faktoren zur Asynchronie der KommunikationKommunikationasynchrone bei.
2.2 Semiotische Ressourcen: Multimedialität und MultimodalitätMultimodalität
Читать дальше