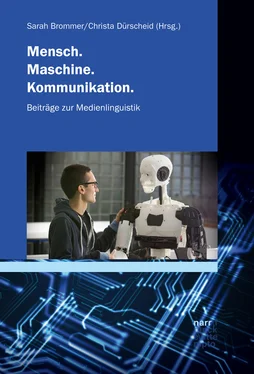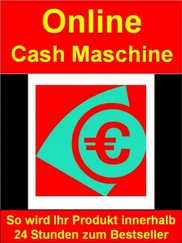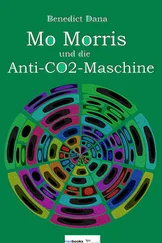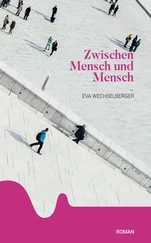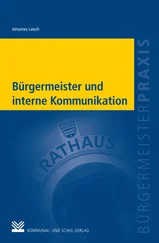Auch Gert Antos warnt in seinem Beitrag «Wenn RoboterRoboter ‹mitreden› … Brauchen wir eine Disruptions-Forschung in der Linguistik?» davor, dass MaschinenMaschine Menschen immer ähnlicher werden könnten: «Je ‹echter› MaschinenMaschine ununterscheidbar und unauffällig Menschen imitieren, umso mehr wächst nicht nur die Gefahr der Tarnung, Täuschung und der Manipulation» (Antos 2017: 399). Und er konstatiert pessimistisch, der Mensch habe «sein bisher gattungsgeschichtliches Monopol auf Reden, Schreiben, Übersetzen und Textherstellen an RoboterRoboter (Sprach-Assistenten) mit aktuell erreichter künstlicher IntelligenzKünstliche Intelligenz verloren» (ebd.: 412). Hier möchten wir allerdings zu bedenken geben, dass Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz noch weit entfernt ist von der menschlichen Fähigkeit, sich Wissen zu beliebigen Themen anzueignen, Schlussfolgerungen zu ziehen, Sprachen anzuwenden und eigene Gedanken zu formulieren.EthikKünstliche Intelligenz10 Denn im Gegensatz zu Menschen können MaschinenMaschine nicht alle beliebigen Arten von Informationen verarbeiten und nur solche Aufgaben bewältigen und Probleme lösen, für die sie programmiert wurden. Entsprechend bleiben auch die Unterschiede in der Mensch-Mensch- und Mensch-Maschine-KommunikationMensch-Maschine-Kommunikation bestehen. Ob diese Grenzen jemals verschwimmen, halten wir für fraglich, zumal dies, wie oben angedeutet, in der Forschung zur Künstlichen IntelligenzKünstliche Intelligenz gar nicht als erstrebenswert erachtet wird. Festhalten können wir auf jeden Fall, dass MaschinenMaschine in immer mehr Situationen des täglichen Lebens unseren Alltag erleichtern und Aufgaben übernehmen, die früher Menschen vorbehalten waren.Künstliche Intelligenz11 Gleichzeitig ist offensichtlich, dass ihr Einsatz den Menschen vor immer neue Herausforderungen stellt. Dazu gehört nicht zuletzt, dass ihnen der Mensch vertrauen muss. Oder vorsichtiger formuliert: Er muss sich auf sie verlassen können.
4 Übersicht über die folgenden Beiträge
Zum Schluss sollen noch die Beiträge des Sammelbandes kurz vorgestellt werden. Dabei handelt es sich in erster Linie um Arbeiten von Germanistikstudierenden der Universität Zürich, die das von uns geleitete Seminar «Mensch. MaschineMaschine. VertrauenVertrauen» besuchten. Einige der studentischen Arbeiten waren von solch innovativem Charakter, dass wir uns dazu entschlossen haben, sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.1 Unterstützt wurden wir dabei von Ilona Straub und Oliver Bendel, die sich bereit erklärten, aus ihrer jeweiligen fachlichen Perspektive ebenfalls einen Beitrag für den vorliegenden Sammelband zu verfassen. Allen Mitarbeitenden an dem vorliegenden Sammelband sei an dieser Stelle herzlich für ihr Engagement gedankt!
Der erste Themenblock trägt die Überschrift «Mensch-Mensch-Kommunikation via MaschineMaschine». Hier geht es um solche Aspekte, die in der Medienlinguistik zur interpersonalen KommunikationKommunikationinterpersonale gerechnet werden. Im ersten Beitrag befasst sich Linda Bosshart mit der WhatsApp WhatsApp-Kommunikation, der Kommunikation via iMessage iMessage und der E-MailE-Mail-Kommunikation. Sie zeigt an einigen Beispielen auf, in welchem Verhältnis die technischenTechnik Gegebenheiten (d.h. die Affordanzen) dieser Kommunikationsformen zu dem stehen, was in diesem Rahmen kommunikativ auch tatsächlich realisiert wird. Roberto Tanchis und Leonie Walder widmen sich sodann dem Gebrauch von Animojis, d.h. von selbst erstellten Avataren (z.B. einem Katzenkopf), die auf einem Foto des eigenen Gesichts (inkl. der Mimik) basieren. Erläutert wird hier u.a., weshalb Animojis in Sprachnachrichten genutzt werden und wo die Unterschiede zu anderen bildhaften Darstellungen in der Online-Kommunikation liegen (z.B. Emojis und Memojis). Der folgende Beitrag von Mia Jenni handelt von «Lil Miquela», einer InfluencerinInfluencer*in, die mit ihren Posts auf InstagramInstagram und YouTube sehr präsent ist und über 2,4 Millionen Abonnent*innen hat. Tatsächlich ist es aber keine Person, sondern eine von einer Startup-Firma kreierte Figur, deren Auftreten so echt ist, dass sich ihre vielen FollowerFollower*in*innen immer wieder täuschen lassen. Den Abschluss dieses ersten Teils bildet der Beitrag von Florina Zülli. Sie beschreibt die Veränderungen des Online-DatingsDating von Parship Parship über Tinder Tinder bis hin zum künstlichen Partner, den man nicht um werben kann, sondern er werben muss.
Der zweite Themenblock führt ins Zentrum des vorliegenden Sammelbandes: Ilona Straub legt dar, mit welcher ErwartungshaltungErwartungshaltung NutzerNutzer*in*innen RoboternRoboter gegenübertreten, und zeigt auf, dass sie diese zunächst als technischesTechnik Objekt, dann als situativ reagierende Gestalt und schliesslich als akzeptierte Sozialpartner wahrnehmen. Jana Seebass vergleicht «Streitgespräche in der Mensch-Mensch- und Mensch-Maschine-KommunikationMensch-Maschine-Kommunikation». Dabei stützt sie sich auf eine Episode aus der bekannten britischen NetflixNetflix-Serie Black Mirror , in der eine junge Frau ihren verstorbenen Mann durch einen RoboterRoboter ersetzt, der diesem, so scheint es zunächst, täuschend ähnlich ist. Zwar handelt es sich dabei um ein fiktives Szenario, der Beitrag führt aber deutlich vor Augen, wo die Gemeinsamkeiten und wo die Unterschiede in der Kommunikation mit einem Menschen resp. einem RoboterRoboter liegen. Mit dem Beitrag von Rahel Staubli rückt sodann das Thema VertrauenVertrauen in den Fokus. Am Beispiel des RobotersRoboterPflege- Lio , der in der Pflege zum Einsatz kommt, wird gezeigt, welche Strategien in einer Werbebroschüre eingesetzt werden, um diesen RoboterRoboterPflege- menschenähnlichmenschenähnlich und damit besonders vertrauenswürdigvertrauenswürdig erscheinen zu lassen. Auch der vierte Beitrag knüpft an die Frage an, wie Vertrauen zu PflegeroboternRoboterPflege- aufgebaut werden kann: Andrea Knoepfli legt dar, dass hierfür nicht nur das Äussere und ein adäquates Kommunikationsverhalten eine wichtige Rolle spielen, sondern dass in der ProgrammierungProgrammierung von RoboternRoboterPflege- noch viele weitere Entscheidungen zu treffen sind, die u.a. ethischeEthik Fragen tangieren (z.B. hinsichtlich der Medikamentenabgabe an Pflegebedürftige).
Auch der dritte Themenblock ist der Mensch-Maschine-KommunikationMensch-Maschine-Kommunikation gewidmet, der Schwerpunkt liegt nun aber auf der Kommunikation mit virtuellenvirtuell Assistenzsystemen. Ein Beispiel hierfür ist Siri Siri – ein Assistenzsystem, das von den Werkeinstellungen her mit einer weiblichen Stimme spricht. An diesem Punkt setzt der Beitrag von Julia Degelo an. Diskutiert werden u.a. die folgenden Fragen: Welche Assoziationen sind mit der weiblichen Stimme verbunden? Würden sich StereotypeStereotyp aufbrechen lassen, wenn die SprachassistenzSprachassistenz eine genderneutrale Stimme hätte? Müsste sich dann aber nicht auch das Kommunikationsverhalten ändern? Der folgende Beitrag trägt den Titel «Smart HomesSmart Home im öffentlichen Diskurs. Drei Fallbeispiele». Hier wird der Blick auf die Berichterstattung über die Nutzung von Assistenzsystemen gerichtet; genauer: auf die Frage, wie diese Thematik medial so aufbereitet wird, dass die technischenTechnik Zusammenhänge auch für Laien unmittelbar verständlich sind. Ann Fuchs und Zora Naef zeigen dies am Beispiel von drei Zeitungsartikeln, die sich an eine breite Leserschaft wenden und das Thema auf ganz unterschiedliche Weise behandeln.
Der vierte Themenblock wurde von uns als «Exkurs» gekennzeichnet. Dies gilt in zweifacher Hinsicht: Zum einen fällt darunter nur ein Beitrag (und der einzige in englischer Sprache), zum anderen geht es nun nicht mehr um die Mensch-Mensch- bzw. Mensch-Maschine-KommunikationMensch-Maschine-Kommunikation im engeren Sinne, sondern um neue technischeTechnik Entwicklungen, die unter das Stichwort «Bodyhacking» fallen. Dazu gehören Beispiele wie das Einsetzen von Chips und Prothesen in den menschlichen KörperKörper. Während es sich dabei aber um einen vergleichsweise minimalen Eingriff handelt, der dazu dienen soll, die Funktionsfähigkeit des menschlichen Körpers wiederherzustellen, gibt es andere, die die Unterscheidung von Mensch und MaschineMaschine grundsätzlich in Frage stellen (und uns dazu veranlasst haben, diesen Themenblock mit «Menschmaschine» zu überschreiben). Ein Beispiel hierfür sind sog. CyborgsCyborg, die Implantate in sich tragen, mit denen sie kommunizieren. Oliver Bendel erläutert dies in seinem Beitrag genauer und erklärt weitere grundlegende Termini (z.B. Biohacking, Bodyhacking, TranshumanismusTranshumanismus). Dann folgt ein Überblick über die Möglichkeiten, die das Bodyhacking bietet, und abschliessend werden damit verbundene ethischeEthik Fragen diskutiert.
Читать дальше