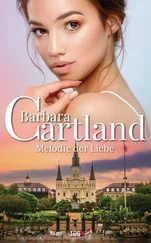Anfangs war ich naiv. „Jetzt, wo mir das passiert ist, muss mich doch jeder lieb haben.“ Dass sich das nicht automatisch so ergab, musste ich irgendwann akzeptieren. Nach und nach sickerte es zu mir durch, dass mancher ein Problem mit mir und meiner Art zu trauern hatte. Dass es manche sogar schmerzte, was ich tat. Helis Familie fand es zum Beispiel ganz furchtbar, dass ich Spielzeug und Erinnerungsstücke so schnell verschenkte. Doch ich kümmerte mich anfangs einfach nicht um die anderen. Vieles von dem, was an Gefühlen in mir schlummerte, war mir unheimlich. Einiges getraute ich mich nicht zuzulassen oder gar anzusprechen. Das trug natürlich nicht gerade dazu bei, die Tiefe des Grabens zwischen mir und meinen Mitmenschen zu verringern.
Mittlerweile kann ich akzeptieren, dass ich als Trauernde, egal, wie tragisch mein Schicksal auch ist, nicht automatisch die Liebe und Sympathie aller habe. Irgendwann kam sogar ein Satz, mit dem ich nie gerechnet hätte, und zwar gleich von mehreren Seiten. „Jetzt hör aber auf mit deiner Trauer!“ Ironischerweise stammte er teilweise von den gleichen Leuten, die vorher gemeint hatten: „Du verdrängst den Schmerz und solltest ihn mehr zeigen.“ Mit dem Tod meiner Familie war ich mit einem Mal nicht mehr so wie alle anderen. Ich war eben ... trauernd.
Das gab mir eine neue Art von Identität. Dieser Status des Besonderen war wenigstens etwas, das mich stützte. Bald tauchte ich in den Medien auf, im Fernsehen, in Magazinen...
Irgendwann passte es allerdings für mich nicht mehr, immer nur „die Trauernde“, „die Frau mit dem Schicksal“ zu sein. Ich wollte lieber wieder ein ganz normaler Mensch sein. Doch das war nicht so leicht. Ich hoffte tatsächlich, dass alles eines Tages „wie früher“ sein würde, wenn ich die Trauer hinter mich gebracht hätte. Irgendwann wurde mir jedoch klar, dass das Leben „danach“ keine Rückkehr in meine vertraute Existenz bedeuten würde. In vielen Situationen wurde deutlich, dass ich anders war als früher. Einerseits war ich viel reifer und milder, andererseits überforderten mich viele lebenspraktische Dinge plötzlich. Teilweise konnte ich es nicht ertragen, wenn Kinder in meiner Nähe waren.
An dem Tag, als ich erkannte, dass ich nicht mehr wie alle anderen war, aber mich auch nicht ewig an dem Status der „Trauernden“ festhalten konnte, fiel ich buchstäblich in ein tiefes Loch.
Eine Zeit lang tat ich mir selbst unglaublich leid. Ich fühlte mich zutiefst unverstanden. Es war schrecklich, wenn jeder sagte: „Erkläre es mir einfach, ich höre zu.“ Das konnte ich beim besten Willen nicht. Es fehlten mir die Worte, und wenn welche kamen, stifteten sie nur noch mehr Verwirrung. Meinem Partner Ulrich gelingt bis heute das schwierigste Kunststück: Mich anzunehmen, auch wenn er mich einmal nicht verstehen kann. Das ist für mich die hohe Schule der Liebe. Er sagt dann oft: „Ich habe davon keine Ahnung, bin aber für dich da. Was kann ich tun?“ Meine Antwort lautet meistens: „Bleib einfach nur bei mir und ertrage mit mir mein Schweigen.“ Das ist schwer genug auszuhalten und nicht gleich eine Lösung parat zu haben.
Es ist schon seltsam. Jemand stirbt, und plötzlich ist man „in Trauer“. Aber was heißt das genau? Und wie geht das eigentlich? Alle Augen schauen auf dich. Mitleidsvoll, aber auch irgendwie voller Erwartung. „Sag uns, was du brauchst. Sag uns, wie es dir geht. Sag uns, was wir tun können.“ Ich war mit diesen Fragen völlig überfordert. Meine Familie war von einem Tag auf den anderen gestorben, ich konnte nicht sofort auch noch die perfekte Trauernde sein. Das ist wie beim Eislaufen. Man fällt anfangs ständig auf die Nase, und irgendwann kann man es plötzlich. Oder auch nicht. Beim Eislaufen zieht man die Schlittschuhe aus, wenn man keine Lust mehr hat oder die blauen Flecken schon zu wehtun. Bei der Trauer hat man diese Entscheidungsfreiheit nicht.
Doch auch das Trauern musste ich erst lernen. Es dauerte lange, bis ich begriff, dass Trauern nicht nur Weinen heißt und Taschentücher entgegennehmen. Es heißt auch: die eigene Wut aushalten, sich nicht überfordern, die eigenen Grenzen erkennen und ausdrücken. Das ist schon unter normalen Umständen schwierig. Wenn ich es zum Beispiel bei einem langen Abendessen im Freundeskreis nicht mehr aushalte und am liebsten sofort heimfahren würde, bin ich oft nicht in der Lage, es klar auszudrücken. Dann beginne ich zu leiden und rutsche sofort wieder in meinen Teufelskreis: „Heli, wenn du doch nur da wärst...“
Barbaras Trauerbewältigung hatte viele Gesichter. Immer wieder besuchte sie den Bahnübergang, an dem der Unfall geschah. Sie schrieb Briefe an ihre Kinder, über ihre Liebe, ihre Gedanken und Gefühle. Sie richtete eine eigene Email Adresse für ihre Kinder ein, Postadresse: Himmelweg 8.
„Die Trauer hält sich an kein Schema, zumindest an keins, das einfach zu entschlüsseln wäre. Wir sind es normalerweise gewohnt, linear zu denken. Alles im Leben muss möglichst direkt von A nach B führen. Ganz Hollywood gaukelt uns in seinen Filmen vor, dass schwierige Ereignisse zwangsläufig zum Happy End führen müssen, pünktlich nach neunzig Minuten. Ich selbst dachte anfangs, dass der Plot der Trauer so ähnlich verlaufen würde. Am Anfang am schmerzhaftesten, dann Schritt für Schritt in Richtung neues Glück. Und auch meine Freunde erlagen diesem Irrtum. Ihre Rechnung sah so aus: Barbara ging es gestern sehr schlecht, heute ein bisschen besser. Also wird es ihr morgen noch besser gehen und schon bald wieder ganz gut. Sie begriffen vielleicht, dass alles in kleinen Schritten geht, aber dass der Weg nicht nur bergauf geht, wollten viele nicht wahrhaben. Ich nehme mich da selbst nicht aus.
Die Trauer ist eher wie eine Wippschaukel, die mal höher und mal weniger hoch ausschlägt. Sie hält Überraschungen bereit. Auch wenn es mir noch so gut geht, kann mein Gefühlsleben rasch auf die andere Seite kippen. Das kann ziemlich wehtun, so ohne Vorbereitung. Genauso aber reicht, wenn es mir gerade schlecht geht, mitunter eine Kleinigkeit aus, um die Sonne wieder scheinen zu lassen. Ein Glas Wasser, eine süße Orange – und auf einmal ist alles anders, und ich denke mir: „Was war denn gerade, was hatte ich denn jetzt?“ Insgesamt hat es aber über die Jahre eine Entwicklung gegeben, die nicht nur beliebig ist. Am schwierigsten ist für mich die Rückkehr ins Leben. Da warten die Herausforderungen des Alltags, und es ist oft leichter, wieder den Rückzug anzutreten.
Anfangs legte ich mich oft ins Bett und verband mich mit der zarten Energie, die ich beim Gedanken an meine Familie spürte. Heli, Timo und Fini waren auch im Leben sehr zarte Seelen. Sie hatten für mich immer etwas Zerbrechliches. Nun, nach ihrem Tod, hatte ich große Angst davor, dass mir die zarte Verbindung zu ihnen verloren gehen würde, sobald ich wieder ins Leben mit seiner Lautstärke und Grobheit zurückkehrte. Ich ging in dieser Zeit etwas aus meinem Körper heraus und wollte von der Erde lieber nichts wissen. Auch heute noch habe ich Schwierigkeiten mit lauten, groben Situationen. Dann zieht es mich zu meiner Familie in ihrer Feinheit. Immer noch plagt mich manchmal die Angst, die Verbindung nach oben plötzlich zu verlieren. Der Schmerz kommt, wenn ich sie nicht mehr spüre, wenn plötzlich alles laut und durch und durch weltlich ist und ich die leisen Stimmen ihrer Seelen nicht mehr wahrnehmen kann.
In den eigenen Körper zurückzukehren war ein schwieriger Prozess. Er ging auch einher mit regelrechten Entzugserscheinungen. Plötzlich meine Familie nicht mehr umarmen zu können, keine Richtung mehr zu haben und kein Gegenüber. Das verstand mein Körper nicht sofort. Gott sei Dank gab es ein großes Stofftier meiner Kinder, einen Walfisch, den ich fest in den Arm nehmen konnte.
Auch ihre Urnen spielten eine Rolle. Die Urne von Heli ist ziemlich schwer, sie wiegt vielleicht zehn Kilo. Ich bin froh, dass ich sie zu Hause aufstellen durfte. Ich nahm sie oft in den Arm, hielt sie und ließ mich von ihrem Gewicht trösten. Als hätte er gesagt: „Schau, es ist ja noch etwas da.“ Es war für mich unvorstellbar, diese Urnen auf einen Friedhof zu bringen, wo sie hinter Glas sind und ich sie zwar noch anschauen, aber nicht mehr anfassen darf. Das ist heute noch keine Option für mich. Aber Urnen zu Hause zu haben ist auch nicht überall selbstverständlich. In Österreich ist es nur in manchen Bundesländern möglich. In der Steiermark ging das Gott sei Dank. In Wien, wo ich jetzt lebe, ist es ein bürokratischer Spießrutenlauf, wenn man darum ansuchen will. Es grenzt an Erniedrigung und ist unwürdig. Ich habe noch immer keine Lösung. Momentan warten die Urnen in der Bestattung auf meine Entscheidung. Vielleicht finden sie einen geeigneten Platz im Garten des Hauses, das Ulrich und ich gerade bauen. Auch die sterblichen Überreste fordern eben ihren Platz, unabhängig davon, dass meine Familie längst in meinem Herzen ein Heim gefunden hat.
Читать дальше