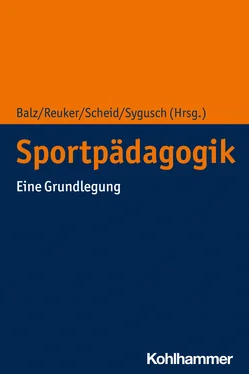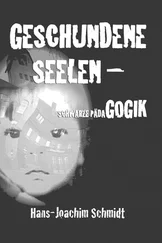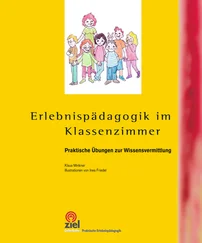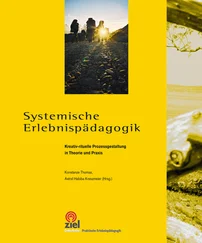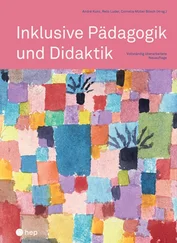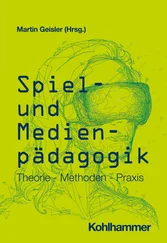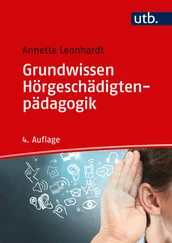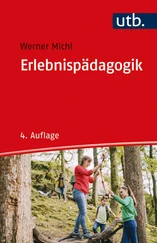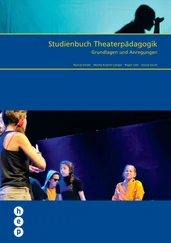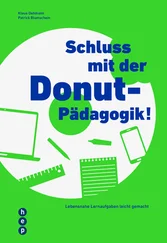Der vorliegende Band ist in fünf große Teile strukturiert. Als Ausgangspunkte der Sportpädagogik liefern die ersten drei Kapitel grundlegende Orientierungen für die folgenden Ausführungen. Die Klärung von Begriffen ist dabei unumgänglich. Darüber hinaus sensibilisieren die differenzierten Ausführungen in Kapitel 1 aber auch für die Notwendigkeit, sich der Begriffsbestimmungen im kritischen Diskurs immer wieder neu zu vergewissern. Für das Verständnis aktueller sportpädagogischer Positionen sind zudem Entwicklungsverläufe von zentraler Bedeutung, die über die Darstellung der Genese der Sportpädagogik in Kapitel 2 dargestellt werden. Das dritte Kapitel beschäftigt sich schließlich mit einem Kernanliegen der Sportpädagogik, indem es verschiedene Systematiken bezüglich ihrer Aufgaben, Arbeitsgebiete sowie Betrachtungs- und Zugangsweisen skizziert und damit Grenzen und Herausforderungen der Sportpädagogik aufzeigt.
Kapitel 4 bis 6 thematisieren bildungs- und entwicklungstheoretische sowie bewegungskulturelle Zugänge als Grundlagen der Sportpädagogik. Auch hier werden verschiedene Perspektiven heraus- bzw. gegenübergestellt. In Kapitel 4 stehen dabei bildungstheoretische Überlegungen in einem engen Implikationszusammenhang zu anthropologischen Grundlagen, die hier in ihren unterschiedlichen Auslegungen und Schwerpunktsetzungen dargestellt werden. Kapitel 5 erörtert verschiedene theoretische Ansätze im Kontext eines vielschichtigen Entwicklungsbegriffs und zeigt darauf aufbauend empirische und konzeptionelle Perspektiven auf. Die Verbindung zum Gegenstand erfolgt in Kapitel 6, in dem unterschiedliche sport- und bewegungskulturelle Zugänge vorgestellt werden. Dabei werden jugendliche Trendsportkulturen beispielhaft etwas näher beleuchtet.
Daran anschließend lassen sich sportpädagogische Orientierungen ableiten, die in Kapitel 7 bis 9 als Orientierung an der Sache, am Individuum sowie deren Synthese unterschieden werden. Kapitel 7 zeigt dabei unter Darstellung verschiedener fachdidaktischer Konzepte das kontroverse Ringen um einen Minimalkonsens zum Gegenstandsverständnis auf. Demgegenüber werden in Kapitel 8 individuumbezogene Orientierungen hervorgehoben, die sowohl konzeptionell als auch empirisch Entfaltungsmöglichkeiten der Subjekte fokussieren. In der Überzeugung, dass eine einseitige Fokussierung auf eine dieser beiden Positionen zu problematischen Verkürzungen führt, werden in Kapitel 9 schließlich Konzeptionen betrachtet, die von der Idee einer Synthese materialer und formaler Bildungsauffassungen ausgehen.
Nach einer kurzen gemeinsamen Einführung wird in den beiden folgenden Kapiteln die Breite und Vielfalt sportpädagogischer Forschung und deren Erkenntnisgewinnung thematisiert. Dabei gibt Kapitel 10 einen Überblick über grundlegende Entwicklungslinien und zeigt anhand von exemplarischen Studien die Vielfalt methodischer Zugänge auf. In Kapitel 11 wird der Versuch unternommen, diese Vielfalt zu systematisieren, indem die sportpädagogischen Forschungsansätze anhand prototypischer Studien verschiedenen Gegenstandsbereichen zugeordnet werden. Der Überblick zeigt Stärken, aber auch Desiderate sportpädagogischer Forschung auf, die es in zukünftigen Forschungsaktivitäten aufzugreifen gilt.
Der letzte große Teilbereich widmet sich in Kapitel 12 bis 15 sportpädagogischen Anwendungsbezügen, die vielfältig sind und im Rahmen dieses Grundlagenwerks lediglich exemplarisch behandelt werden können. In Kapitel 12 werden formale, non-formale und informelle Settings aufgezeigt, in denen Menschen Sport- und Bewegungsaktivitäten nachgehen. Anhand ausgewählter Merkmale werden diese Settings mit Blick auf dort stattfindende Bildungsprozesse einander gegenübergestellt. Kapitel 13 fragt nach der Professionalisierung der Personen, die in diesen Settings vermittelnd tätig sind. Dabei werden verschiedene Professionalisierungsansätze anhand sportpädagogischer Forschungserkenntnisse und konzeptioneller Überlegungen exemplarisch veranschaulicht. Kapitel 14 nimmt dann die Akteur*innen in den Blick und fokussiert sich dabei auf deren Differenzen. Mit den Differenzkategorien Behinderung, Geschlecht und Migration werden drei dominierende Bereiche zunächst dargestellt, bevor die Frage nach der Notwendigkeit von Kategorisierungen kritisch hinterfragt wird. Schließlich liefert Kapitel 15 einen exemplarischen Überblick über Bildungsthemen und stellt zu den Themen Leistung, Gesundheit und Soziales sportpädagogische Ansprüche und Wirklichkeiten dar. Dabei wird auch hier, unter Berücksichtigung der verschiedenen Settings, die Breite und Vielfalt der Perspektiven aufgezeigt.
Die Sportpädagogik sieht sich mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, die im letzten Kapitel aus einer retrospektiven, introspektiven und prospektiven Sicht exemplarisch vertiefend bilanziert werden. In einer Schlussbetrachtung sind zudem die in den fünfzehn Kapiteln thematisierten Herausforderungen noch einmal prägnant zusammengefasst, um den in diesem Buch aufgezeigten konstruktiven Diskurs vielschichtiger Perspektiven weiter anzuregen.
Balz, E. & Kuhlmann, E. (2015). Sportpädagogik. Ein Lehrbuch in 14 Lektionen (Sportwissenschaft Studieren, Band 1) (5. Aufl.). Meyer & Meyer (1. Aufl. 2003).
Dietrich, K. & Landau, G. (1999). Sport-Pädagogik (2., unver. Neuaufl.). Afra-Verlag (1. Aufl. 1990, Rowohlt).
Grupe, O. & Krüger, M. (1997). Einführung in die Sportpädagogik (Sport und Sportwissenschat, Band 6). Hofmann.
Haag, H. & Hummel, A. (Hrsg.) (2009). Handbuch Sportpädagogik (Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport, Band 133) (2., erw. Aufl.). Hofmann (1. Aufl. 2001).
Krüger, M. (2019). Einführung in die Sportpädagogik (Sport und Sportwissenschat, Band 6) (4., überarb. und aktual. Aufl.). Hofmann.
Meinberg, E. (1996). Hauptprobleme der Sportpädagogik. Eine Einführung (3., unveränd. Aufl.). Wiss. Buchgesellschaft (1. Aufl. 1984).
Prohl. R. (1991). Sportwissenschaft und Sportpädagogik. Ein anthropologischer Aufriss (Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport, Band 101). Hofmann.
Prohl, R. (2010). Grundriss der Sportpädagogik (3., korr. Aufl.). Limpert (1. Aufl. 1999).
I Sportpädagogische Ausgangspunkte
1 Grundbegriffe der Sportpädagogik
Volker Scheid & Verena Oesterhelt
Begriffe und ihre jeweilige Bestimmung dienen als Anker für den Aufbau eines fundierten Verständnisses eines Fachgebiets. Mit der Klärung von Kerngedanken lassen sich hinzukommendes Wissen ebenso wie kontextbezogene Erfahrungen einordnen. Damit trägt die Auseinandersetzung mit Begriffen zum weiteren Auf- bzw. Ausbau von Denkstrukturen bei. Auch für den fachlichen Austausch ist die Klärung von gemeinsam geteilten Begrifflichkeiten bedeutsam. Dies gilt insbesondere mit Blick auf komplexe Zusammenhänge sozialer Realitäten, wie im hier vorliegenden Fall: dem (sport-)pädagogischen Handlungsfeld. Begriffe sind, anders als naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten, immer angewiesen auf eine kontinuierliche Vergewisserung ihres Bedeutungsgehalts, da dieser – im Sinne einer sozial-kulturellen Vereinbarung – einer normativen Setzung entspricht. Ein Begriff kann im Zeitverlauf durchaus auch anders gedeutet werden. Damit bildet eine Auseinandersetzung auch die Chance auf eine Selbstvergewisserung innerhalb eines Fachgebiets. In diesem ersten Kapitel des Buches werden entsprechend grundlegende Begriffe der Sportpädagogik anhand exemplarischer Deutungen geklärt.
1.1 Definitionsansätze und Merkmale der Sportpädagogik
Meinberg (1996) beginnt sein Einführungswerk Hauptprobleme der Sportpädagogik mit einer Standortbestimmung. Er beschreibt die Sportpädagogik als
»diejenige Teildisziplin der Erziehungs- und Sportwissenschaft, die das sportliche und spielerische Bewegungshandeln in seinen institutionalisierten und nichtinstitutionalisierten Formen vorrangig unter den Motiven Bildung, Erziehung, Sozialisation und Lernen mit Hilfe verschiedenartiger Forschungsmethoden untersucht« (ebd., S. 17).
Читать дальше