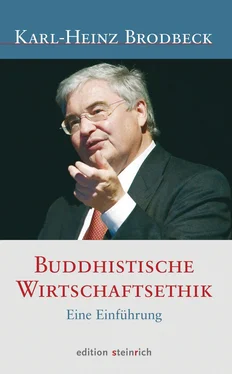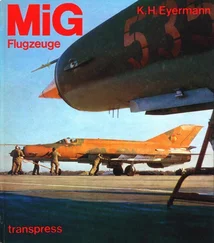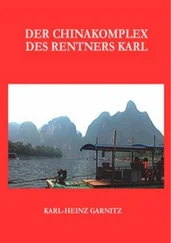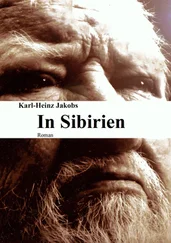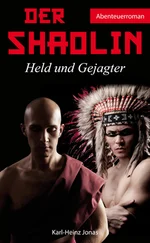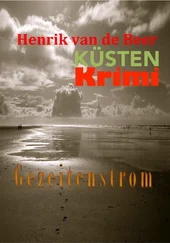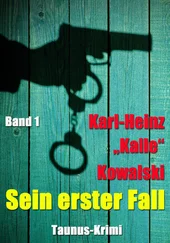Welcher »Reformvorschlag« auch immer Mitgefühl und Achtsamkeit fördert, das Leiden vermindert, wird deshalb von sozial engagierten Buddhisten begrüßt werden. Sie selbst haben keine vorgefasste, einseitige Idee vom »Wesen der Gesellschaft«, außer der kritischen Einsicht, dass die Gesellschaft meist das Resultat von Egoismus und irrigen Auffassungen, eher selten von Gemeinsinn und Mitgefühl ist. Der Buddha hat den Menschen viele praktische Ratschläge in ihrer konkreten Lebenssituation gegeben. Dennoch hat er ausdrücklich keine Theorien, keine Ansichten oder Ideen über die Menschen und die Gesellschaft vertreten. Und Nāgārjuna, der Vater des Mādhyamaka, der Philosophie des Mittleren Weges, betonte immer wieder, dass er zwar helfe, Irrtümer bei anderen Denkformen zu durchschauen, selbst aber ausdrücklich keine Denkform vertrete. 8Darin liegt eine tiefe Weisheit, die westlichem Ideenglauben nicht leicht einsichtig zu machen ist: Wer eine bestimmte Idee oder Theorie (z. B. zur Reform der Wirtschaft) vertritt und verteidigt, der tritt dadurch in Konkurrenz zu anderen Ideen. Ideen unterscheiden sich von anderen, sie haben sozusagen ihr eigenes »Ego«, das man sich dann als Anhänger dieser Idee zu eigen macht. Der buddhistische Weg verläuft anders. Er nimmt den Ideen von innen ihren Ichkern und verhilft zur Erkenntnis der notwendigen Einseitigkeit jeder Theorie der Gesellschaft oder der Weltwirtschaft. Dieser Weg ist der Weg des Mitgefühls, der Achtsamkeit – ein Weg des Loslassens, nicht des Ergreifens von Ideen. Dann kann sich jeder in eine konkrete Wirklichkeit einfügen, ohne auf diese Wirklichkeit und ihre Gegensätze hereinzufallen und sich zu sehr beunruhigen zu lassen. Deshalb ist die buddhistische Wirtschaftsethik offen für alle konkreten Initiativen und Veränderungsvorschläge, offen für Zusammenarbeit in allen das Leiden mindernden Initiativen, solange nur die Menschen aus eigener Einsicht handeln und darin vor allem Toleranz anderen gegenüber üben. Im Buddhismus werden nicht Denkfehler toleriert, wohl aber betont diese Lehre das Mitgefühl mit Menschen, die ihnen erliegen. Dies ist die Praxis von Toleranz, Gewaltfreiheit, vernünftigem Argumentieren und liebender Güte allen lebenden Wesen gegenüber. Alles andere ergibt sich dann in jeder Situation des Alltags, motiviert durch diesen Geist, ganz von selbst – immer wieder neu, denn bleibend ist nur der Wandel.
Gröbenzell, 15. Dezember 2010
Ich werde mich zunächst ausführlich mit dem beschäftigen, was eigentlich »Buddhismus« bedeutet (Kapitel 1und 2), bevor ich ethische und ökonomische Fragen erörtere. Nach Klärung der philosophischen und psychologischen Grundlagen (Kapitel 2) ergeben sich ethische Lösungsvorschläge (Kapitel 3) und die Folgerungen für die Ökonomie als logische Konsequenz (Kapitel 4). Im fünftenKapitel wird daran anschließend das Verhältnis der buddhistischen Wirtschaftsethik zu anderen ethischen Systemen diskutiert. Die gewonnenen Einsichten erläutere ich im sechstenKapitel an einzelnen Fragen der Wirtschaftsethik (Beruf, Führungsprinzipien, Bevölkerungs- und Familienpolitik, Konsum, Ökologie, Armut, Globalisierung etc.) und im siebtenKapitel zusammenfassend mit Blick auf Probleme des technischen Fortschritts und des Wirtschaftswachstums.
Vorab möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Leserin und der Leser den Begriff »Leiden«, der immer wieder auftauchen wird, einfach auch mit »Erleiden ökonomischer Sachzwänge«, »Abhängigkeit von Sachzwängen« übersetzen kann.
»Die unglücklich sind in der Welt, sie alle sind es
durch das Verlangen nach eigenem Glück.
Die glücklich sind in der Welt, sie alle sind es
durch das Verlangen nach dem Glück der anderen.« 9
Die buddhistische Wirtschaftsethik in dem hier vorgestellten Verständnis verkündet keine Gebote oder Regeln, die man befolgen soll. Sie erklärt vielmehr, weshalb aus irrtümlichen Wahrnehmungen und Gedanken Handlungen entstehen, deren Konsequenzen Leiden verursachen. Aus der Erkenntnis der Ursachen ergeben sich Folgerungen für das wirtschaftliche Handeln. Um negative Konsequenzen für das Handeln zu beseitigen oder zu mildern, muss man die zugrunde liegenden Gedanken verändern. »Wenn man mit verblendetem Geist denkt und handelt, dann folgt das Leiden nach«, heißt es im ersten Vers der ältesten buddhistischen Spruchsammlung, dem Dhammapada. Somit rückt für eine buddhistische Wirtschaftsethik die Veränderung der Motivation und der Erkenntnis in den Mittelpunkt. Ansprechpartner ist hierbei jeweils das Individuum und sein Handeln; erst darauf gegründet lassen sich institutionelle Fragen beantworten.
Die Wirtschaft, so lautet eine alte Lehrbuchdefinition, umfasst alle menschlichen Handlungen, die der Produktion und Verteilung knapper Güter zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse dienen. Man kann weder sagen, dass die globale Wirtschaft diese Aufgabe erfüllt, noch lässt sich feststellen, dass die Ökonomie als Wissenschaft dazu gedient hat, das Allgemeinwohl der Menschen und anderer Lebewesen auf diesem Planeten besonders zu fördern. Sicherlich gibt es und gab es immer wieder Länder, wenigstens Regionen, die über einen sehr hohen Wohlstand verfügen und verfügten. Es gibt aber nur noch wenige Landstriche auf der Erde, in denen Tiere gemäß ihrer natürlichen Ausstattung leben können, und insgesamt zeigt unser Planet das Bild einer wachsenden Desorganisation der Ökosysteme, der »Deregulierung« traditioneller Kulturen, sozialer Strukturen und eine nicht enden wollende Abfolge von Hunger, Krieg, wirtschaftlichen Zusammenbrüchen und Verarmung.
Die Welt ist auch im ökonomischen Sinn durch die Allgegenwart von Leiden charakterisiert. Daran hat sich in 2.500 Jahren wenig geändert, seitdem der Buddha die einfache Einsicht aussprach, dass das wesentliche Kennzeichen des Lebens das Leiden ist. Ich spreche hier gar nicht von den unsäglichen Leiden durch Naturkatastrophen, Kriege oder tyrannische Regierungen, sondern nur vom wirtschaftlich bedingten Leiden. Ein paar Zahlen 10: Man spricht von einer »Fünftel-Gesellschaft«. Das weltweit reichste Fünftel (20 %) der Weltbevölkerung verbraucht 86 % des gesamten privaten Welteinkommens für Konsumzwecke; das ärmste Fünftel konsumiert dagegen nur 1,3%. Genauer aufgeschlüsselt: Das obere Fünftel konsumiert 45% der Weltfleisch- und Fischproduktion, das ärmste Fünftel 5 %; es verbraucht dabei nur 4 % der Weltenergieproduktion, während das obere Fünftel der Konsumenten 58 % der Weltenergie verwendet. Als eine Hauptursache für nahezu alle sozialen, politischen und auch ökologischen Probleme durch Ressourcenverschwendung lässt sich die ungleiche Verteilung der Einkommen identifizieren, die auch in den entwickelten Ländern in den letzten Dekaden teils rapide zugenommen hat. 11
Die Zahl der Hungernden hat 2009 nach Angaben der FAO den höchsten bislang erfassten Wert erreicht: Über eine Milliarde Menschen. Der leichte Rückgang des Hungers nach der Jahrtausendwende wurde durch die horrenden Spekulationen mit Lebensmittelpreisen und durch die Finanz- und Wirtschaftskrise wieder zunichte gemacht. 1280% der weltweit unterernährten Kinder leben in Ländern, in denen gleichzeitig ein Überschuss in der Nahrungsmittelproduktion besteht. 13Die Weltwirtschaft ist also offenkundig bislang nicht in der Lage, die Weltbevölkerung effizient zu ernähren, dies trotz oder wegen der zunehmenden Globalisierung. Stattdessen werden weltweit, allen voran in den USA, immer mehr Mittel für Rüstung und Kriege ausgegeben. Nach Angaben des Forschungsinstituts SIPRI betrugen im Jahr 2009 die weltweiten Rüstungsausgaben trotz Wirtschafts- und Finanzkrise 1,5 Billionen US-Dollar mit einem Anstieg von knapp 50 % seit 2000.
Читать дальше