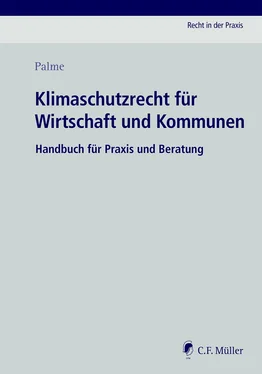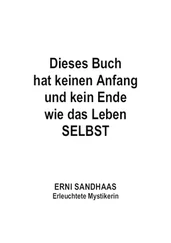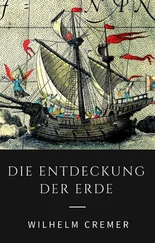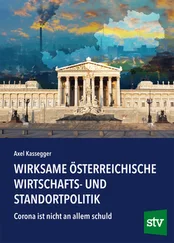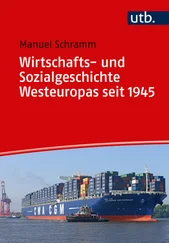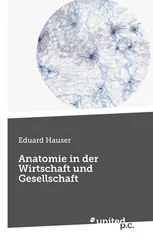215
Ausgangspunkt dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung ist, dass es in Abwesenheit einer unionsrechtlichen Regelung zum Klimaschutz den Mitgliedstaaten freisteht zu entscheiden, ob und auf welchem Niveau sie klimaschützende Maßnahmen ergreifen wollen.
216
Notwendig ist allerdings, dass die ergriffenen Maßnahmen zur Erreichung des Klimaschutzes überhaupt geeignetsind.[269] Hier stellt sich die Frage, ob angesichts der Tatsache, dass Deutschland nur für 2 % der weltweiten CO2-Emissionenverantwortlich ist und angesichts der weiteren Tatsache, dass sich zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen nur auf einen Bruchteil dieser 2 % beziehen, hier überhaupt noch von einem relevanten Einflussnahme auf das weltweite Klima gesprochen werden kann. Richtigerweise wird man dies aber bejahen können, denn jede Tonne CO 2weniger ist gut für das Klima, wenn wohl auch kaum messbar. Man wird die Frage dann aber auf den nächsten Stufen „Erforderlichkeit“ und „Verhältnismäßigkeit“ genauer prüfen müssen.
217
Eine unilaterale Klimaschutzmaßnahme ist dann erforderlich, wenn sie das den freien Warenverkehr am wenigsten behindernde Mittelist.[270] Bei dieser Beurteilung kommt auch den in Art. 191 AEUV anerkannten Zielen und Grundsätzen der Umweltpolitik der Union eine Bedeutung zu, insbesondere dem Ziel eines hohen Schutzniveaus sowie den Grundsätzen der Vorbeugung, der Vorsorge und des Verursacherprinzips.
218
Schließlich muss eine unilaterale Klimaschutzmaßnahme angemessen sein (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne), das heißt, der mit dieser Maßnahme erreichte Gewinn an Klimaschutz darf nicht außer Verhältnis zu der hierdurch verursachten Handelsbeschränkungstehen.[271] Dies erfordert eine Güter- und Interessenabwägung zwischen Klimaschutzbelangen einerseits und dem freien Warenverkehr andererseits. Wegen der besonderen Bedeutung des Umweltschutzes im Unionsrecht, insbesondere mit Blick auf die Querschnittsklausel des Art. 11 AEUV, ließe sich argumentieren, dass dem Klimaschutz allgemein ein höheres Gewicht als der Warenverkehrsfreiheit einzuräumen ist.
219
Letztlich kann diese Frage jedoch nur in konkreten Fallkonstellationen anhand der jeweils relevanten Wertungen des nationalen oder europäischen Gesetzgebers beantwortet werden. Bei der bereits oben erwähnten Problematik des kaum messbaren Beitrags einer unilateralen deutschen Klimaschutzmaßnahmewird man je stärker die Warenverkehrsfreiheit beeinträchtigt wird, in einer Gesamtabwägung eher zum Schluss der Unzulässigkeit der Maßnahme kommen. Andererseits ließe sich aber auch argumentieren, dass zwar der Einfluss allein einer deutschen Maßnahme kaum messbar sein mag, es aber weltweit zahlreiche Regionen und Staaten gibt, die unilateral ambitionierter sind als die politischen Ebenen darüber. Man denke nur an Kalifornien , welches trotz der Leugnung des menschengemachten Klimawandels durch Trump weiterhin eine ambitionierte Klimaschutzpolitik auf Staatenebene betrieb. Und viele solcher Alleingänge weltweit zusammen könnten dann doch einen messbaren Einfluss auf die Klimaerwärmung haben.
6. Räumliche Grenzen unilateraler Klimaschutzmaßnahmen
220
Eine weitere zu überwindende Hürde ist die Tatsache, dass Deutschland bei nationalen unilateralen Klimaschutzmaßnahmen nicht – wie z.B. bei Maßnahmen zur Luftreinhaltung – seine eigene Umwelt schützt sondern mit der Erdatmosphäre ein Gut, welches Deutschland als „global common“ gar nicht zugeordnet ist. Es stellt sich also die Frage, ob die Berufung auf das zwingende Erfordernis Klimaschutz wegen seines mangelnden Bezug zum deutschen Hoheitsgebietüberhaupt zu Einschränkungen der Warenverkehrsfreiheit taugt.
221
Diese Frage wird bis heute diskutiert.[272] Betrachtet man sich die Rechtsprechung des EuGH , dürfte überwiegendes für die prinzipielle Zulässigkeitsolcher unilateralen Maßnahmen sprechen. So hat z.B. der EuGH im Bereich des Abfallrechts angedeutet, dass solche „extraterritorialen” Maßnahmen mit dem AEUV vereinbar sein könnten.[273] Auch die Tatsache, dass der EuGH Einschränkungen des Warenverkehrs zum Schutz der Ozonschicht zuließ, spricht dafür.[274] Ebenfalls hierfür spricht, dass die Bewältigung globaler Umweltprobleme und auch die Klimaschutzpolitik explizit zu den Zielen der Umweltschutzpolitik der Union zählt.[275] Schließlich spricht auch der Ansatz des Pariser Abkommens und der Klimarahmenkonvention dafür, wo stets die Notwendigkeit internationalen Handelns betont wird.
IV. Unilaterale Klimaschutzmaßnahmen bei Vorliegen von Sekundärrechtsakten
1. Mögliche Fallkonstellationen
222
Anders ist die Situation in Bereichen, in denen die EU bereits rechtlich verbindliche Klimaschutzmaßnahmen erlassen hat wie z.B. die EE-Richtlinie, die Energieeffizienzrichtlinie oder die Emissionshandelsrechtlinie. Hier gilt nicht nur das EU Primärrecht. Vielmehr sind auch die entsprechenden Sekundärrechtsakte zu beachten.
223
Angesichts des grundsätzlichen Anwendungsvorrangs des Unionsrechts vor dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten ist die zentrale Frage, ob und inwieweit die Mitgliedstaaten berechtigt sind, unionsrechtliche Wertentscheidungenim Spannungsfeld zwischen Freihandel und Klimaschutz durch eigene Wertentscheidungen zu ergänzen oder sogar zu ersetzen. Hierbei lassen sich drei Fallkonstellationenunterscheiden:
224
(1) Die Kompetenz der Mitgliedstaaten zum Abweichen von sekundärrechtlich festgelegten Klimaschutzstandards ergibt sich aus den einschlägigen Richtlinien oder Verordnungen selbst,[276]
(2) Sekundär-Klimaschutzrecht der EU strebt eine Harmonisierung an, und stützt sich auf die Umweltkompetenz in Art. 192 AEUV,[277]
(3) Sekundär-Klimaschutzrecht der EU strebt eine Harmonisierung an und stützt sich auf die binnenmarktbezogene Harmonisierungskompetenz in Art. 114 AEUV.[278]
2. Sekundärrechtlicher Klimaschutzrechtsakt mit Schutzverstärkerklausel
225
Bei komplexen Regelungsfeldern wie dem Klimaschutz, bei denen unterschiedliche Ausgangsniveaus zwischen den Mitgliedstaaten existieren, gewähren Sekundärrechtsakte der EU den Mitgliedstaaten oft Flexibilität bei der Umsetzung. Dies kann z.B. in der Festlegung unterschiedlicher Schutzniveaus für verschiedene Mitgliedstaaten, in Ausnahmebestimmungen für einzelne Mitgliedstaaten oder in unterschiedlichen Zeitvorgaben für das Erreichen festgelegter Ziele bestehen.
226
Eine Sperrwirkung des Unionsrechtsgegenüber national abweichenden Regelungen existiert daher nur dort, wo der Europäische Gesetzgeber keine Flexibilitätin der Umsetzung zugelassen hat oder aber die in einem Rechtsakt angelegte Flexibilität ausgeschöpft ist (z.B. Auslaufen von Übergangsfristen).
227
Wegen der unterschiedlichen Natur der EU-Regelungsinstrumente ist der Umsetzungsspielraum bei Richtlinien typischerweise größer als bei Verordnungen. Ein Beispiel für eine solche Richtlinie im Spannungsfeld Klimaschutz und Binnenmarkt, die den Mitgliedstaaten ausdrücklich weitergehende Schutzmaßnahmen erlaubt, ist die Energieeffizienzrichtlinie 2012/27/EG. Diese Richtlinie will nur einen Mindeststandard festlegen und erlaubt nach der Schutzverstärkerklausel des Art. 1 Abs. 3den Mitgliedstaaten ausdrücklich auch strengere Maßnahmen.
228
Nutzt Deutschland diesen Spielraum, müssen diese weitergehenden nationalen Klimaschutzmaßnahmen aber mit dem Primärrecht, insbesondere den Grundfreiheiten, vereinbar sein.[279] Die diesbezügliche Prüfung entspricht vollumfänglich den vorstehenden Ausführungen zu nationalen Umweltschutzmaßnahmen im nicht harmonisierten Bereich.[280] Eine Anzeige oder Notifizierung der unilateralen Klimaschutzmaßnahme bei der Kommission ist nicht erforderlich.
Читать дальше