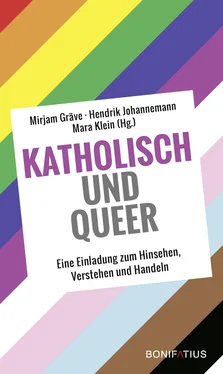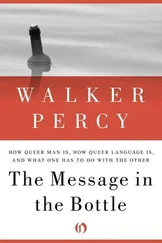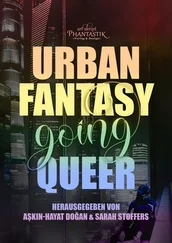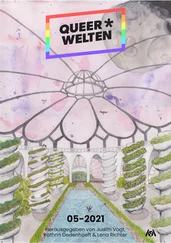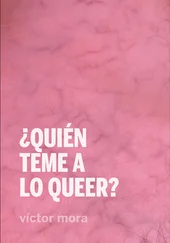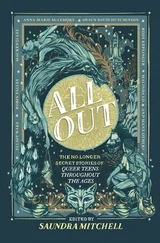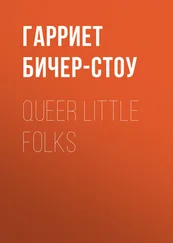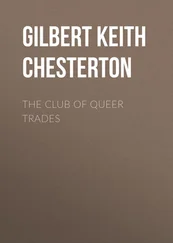Meine Frau und ich sind dieses Jahr seit 20 Jahren zusammen und haben so manchen Sturm gemeinsam durchgestanden, Verantwortung übernommen und uns ganz offensiv mit unserem Glauben auseinandergesetzt. Trotzdem wird uns noch immer ein offizieller Segen für unsere Beziehung in der katholischen Kirche abgesprochen. Auch wenn wir „unter der Hand“ schon mehrfach das Angebot bekamen …
Freundinnen von uns sind konvertiert und mittlerweile evangelisch getraut. Sie sind damit sehr zufrieden. Vor zwölf Jahren haben wir einen Gottesdienst in unserem Garten gefeiert mit einem Versprechen und dem Segen Gottes, den alle Anwesenden für uns erbeten haben. Eine damals noch katholische Freundin und Theologin hat durch den Gottesdienst geführt. Auch sie konvertierte und leitet mittlerweile regelmäßig evangelische Gottesdienste.
8. „Zuerst Vater, dann Mutter von vier katholisch getauften Kindern“
Barbara, geb. 1969
Katholisch sozialisiert, mit einer unbeschwerten und im Rückblick glücklichen Jugend in einem katholischen Internat beschenkt, war es mir selbstverständlich, meine ersten Kinder katholisch zu taufen und zu erziehen.
Warum aber gab es bei meinem jüngsten Kind, einem Nachzügler, dann Zweifel, ob das auch für ihn eine gute Idee ist? Und warum haben wir uns dann doch entschieden, ihn nicht nur zu taufen, sondern auch katholisch zu taufen?
Unsere Ehe ist konfessionsverbindend; lutherisch wäre eine Option gewesen. Ausschlag gegeben hat letztlich, dass wir in der katholischen Gemeinde, der wir verbunden sind, willkommen sind. Dass die Menschen, die uns dort geistlich nahestehen, uns annehmen, wie wir sind: Unsere Ehe ist nicht nur konfessionsverbindend, sondern lesbisch. Unser Kind ist daher offensichtlich mit Spendersamen gezeugt. Und einige Gemeindemitglieder wissen auch, dass ich früher für meine drei älteren und mittlerweile erwachsenen Kinder Vater war und dass ich vor inzwischen 20 Jahren akzeptiert habe, in dieser Welt eine Frau zu sein. Einzelne wissen auch darum, dass ich von meiner damaligen Frau, der Mutter der drei älteren Kinder, geschieden und folglich also auch noch wiederverheiratet bin.
Ich kann mir gut Gemeinden vorstellen, in denen wir nicht willkommen sind, ob nun katholisch wie lutherisch. Wo jeder einzelne der genannten Lebensumstände als „Sünde“ gilt, die mit persönlicher Ablehnung geahndet wird. Wie mag sich das wohl irgendwann im Religions- oder Kommunionsunterricht verhalten? Wenn das Kind auf eine Person trifft, die sich verpflichtet fühlt, ihm zu erklären, dass Mami und Mama in die Hölle kommen, weil sie „in Sünde leben“, in „furchtbarer Sünde, in Todsünde“?
Nicht nur einmal wurde ich außerhalb von Kirche – in meinem rational-naturwissenschaftlich geprägten Beruf, Privatleben und entschieden in queeren Bezügen – gefragt, was ich denn, gerade ich, bei „diesem Verein“ überhaupt noch wolle. Erstaunlicherweise habe ich mich selbst das nie gefragt. Im Gegenteil. Die Liebe meiner Eltern hat mir ein Urvertrauen geschenkt. Immer wieder haben sie beiläufig selbstverständlich Bezüge hergestellt auf den Schöpfergott, der uns Menschen liebt und der die Liebe ist, das Leben und die Lebensfreude. Dieses Urvertrauen in Gott ist in mir verankert. Und im Internat wurde für mich das vom Glauben getragene und getriebene Engagement der Ordensleute erfahrbar, dass die Lebens- und Liebeskraft, die aus Christus strömt, uns heute schon ein bisschen hilft „die Stadt auf der Höh‘“ zu bauen. „Freunde, wir fangen an“ war die Hymne meiner Schule. Und wie meine Internatsschule ist auch die Kirche, der meine Frau und ich verbunden sind, getragen von der besonderen Energie von Ordensleuten, in unserem Fall jetzt Jesuiten.
Zu meinem großen Glück ist auch meine Frau gläubig. Wir haben uns ironischerweise kennengelernt zu einer Zeit, als ich nach Transition, Scheidung und gescheiterten Liebschaften ernsthaft über ein Leben nach den Ratschlägen der evangelischen Räten nachdachte. Johanna wusste, dass ich in gleichgeschlechtlicher Beziehung gelebt hatte und suchte für sich selbst Orientierung – angesichts eines Spannungsfeldes von gleichgeschlechtlicher Zuneigung, frommer (die Homosexualität ablehnender) Sozialisierung und des eigenen Familien- und Kinderwunsches. Ich nahm sie mit in queere Bezüge. Wir unterhielten uns über Gott und die Welt, Gott in der Welt, über das Lesbisch-, Trans- und zugleich Christsein. Über die Verbindung von Naturwissenschaft, Skepsis und Glaube. Und da ich ja mit meinen drei Kindern aus dem Gröbsten raus war und eher über ein eheloses Leben nachdachte als über eine Beziehung, und sie ja Kinder und Familie wollte, haben wir beide – jede für sich – das Herzklopfen, das „Britzeln“, geschoben auf ein „Was weiß ich denn?“, jedenfalls nicht auf uns. Erst Monate später haben wir uns unsere Liebe ein- und zugestanden, spannenderweise im Anschluss an einen gemeinsamen sehr feierlichen Besuch einer Messe, das war zu Allerseelen 2008.
In einer Lebenskrise bin ich über säkulare und östliche Meditation auf christliche Meditation und kontemplative Exerzitien nach Pater Franz Jálics SJ gestoßen. Und ich habe mich getraut, mich darauf einzulassen. Gott sei Dank!
„Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, oder er wird nicht mehr sein“, hat mal der Theologe Karl Rahner gesagt. In der Tat versuchen Menschen wie Franz Jálics SJ, Richard Rohr OFM, Willigis Jäger OSB, Kenneth S. Leong und viele weitere Zeitgenossen sowie alte Mystiker uns Brücken zu bauen. Brücken, die Christen als eine unmittelbare, persönlich geahnte oder erfahrene „Papa“(Abba)-Gottesbeziehung beschreiben. Brücken, die ein „Christ-inesisch“ in unsere Zeit übertragen. Es sind Brücken und Wege, Gott wieder in allen Dingen und Menschen zu finden.
Und währenddessen „verteidigen“ fehlgeleitete Kirchenfunktionäre Dogmen, die Menschen wegen ihrer Liebe aus der Gemeinschaft ausschließen, in deren Mitte die Verbindung steht. Sie beharren auf Dogmen, die Familien entzweien und Kinder mit schrägen Loyalitätskonflikten konfrontieren.
Ich bin überzeugt, dass der Weg aus dieser Groteske durch die persönlich erfahrene Liebe Gottes führt. Durch Begegnung – wie dem Gespräch über gleichgeschlechtliche christliche Paare am Schönstätter Eheweg mit einer Frau auf dem Katholikentag. Und durch Einsicht im Gebet.
Wir haben unseren Jüngsten, in einer lesbischen Ehe gezeugten und geborenen Sohn katholisch getauft aus Liebe zum Leben. Nicht nur, weil „katholisch“ für uns Heimat ist, sondern auch, weil „katholikos“ (griech. für „allumfassend, allgemein, universal“) keine Marke ist, sondern Programm. Diese allumfassende Kirche ist noch nicht vollendet, aber im Werden, und wir sind heute schon mit eingeschlossen, mit unserem Sohn und mit unserer Ehe.
Scheinheiligkeit
9. „Wenn die Kirche so lebt, dann kann mein Leben keine schwerere Sünde sein“
Sebastian, geb. 1990
Glaube und Kirche bildeten für mich gerade in meinen Teenagerjahren einerseits einen großen Halt, als ich zwar spürte, dass ich irgendwie „anders“ fühlte, dachte und mich verhielt als die meisten, aber dies für mich nicht fassen konnte oder wollte. Andererseits blieb dieser Halt immer auch ambivalent, da ich selbstverständlich dennoch gewisse Begehren spürte, sie jedoch zu unterdrücken und auszublenden beziehungsweise umzudeuten versuchte. Erst im Nachhinein ist mir dies verständlich geworden: Liturgie und auch eine gewisse – manchmal sehr übertriebene – Frömmigkeit boten einerseits Orientierung und Geborgenheit, sicher waren sie aber auch – durch ihre Überhöhung – eine Art Weltflucht. Und gleichzeitig nährte ein konservatives, sehr regelfixiertes Glaubensverständnis die Angst, dass ich wegen unkeuscher Gedanken und Handlungen von Gott endgültig verstoßen würde.
Читать дальше