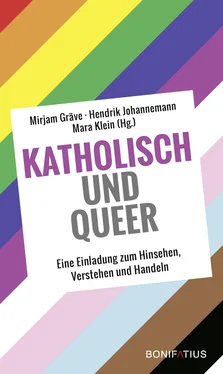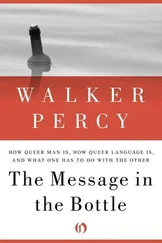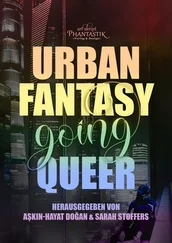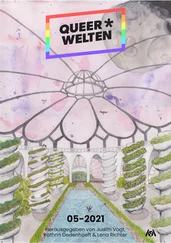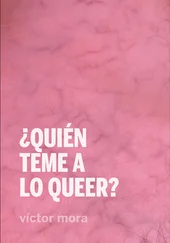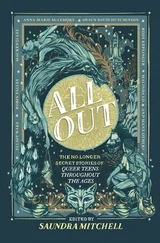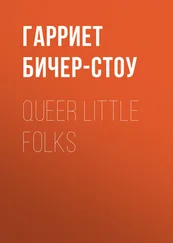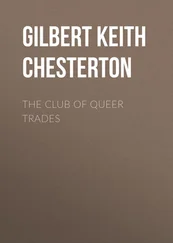Ich sagte nur: „Wie stellst du dir das vor? Soll ich mein Kind verleugnen?“ Und konkreter: „Soll ich meinem Jungen von einem liebenden Gott erzählen, der ihn so, wie er ist, wunderbar geschaffen hat und ihn liebt, und ihm gleichzeitig sagen, dass ich so tun muss, als gäbe es weder ihn noch meine Frau, weil die Kirche, in der von dieser Liebe gepredigt wird, mich sonst rausschmeißt? Hat mein Sohn so überhaupt die Chance, eine unvoreingenommene Beziehung zu Gott aufzubauen?“
Er meinte nur, dass er mir dann kündigen muss. Gleichzeitig wusste ich aber auch, dass er persönlich mit meiner Lebensweise gar kein Problem hatte. Er musste es tun. Und das macht es dann auch schwer, sauer zu sein. Ich wäre so gern sauer, aber diese Person, die mir das angetan hat, ist hier einfach nicht der richtige Adressat.
Wie hat sich dein Verhältnis zur Kirche und zum Glauben nach der Kündigung verändert? Wie bindet ihr den Glauben in euer Familienleben ein?
Ich hatte gut zwei Jahre Zeit, mich mit dem Gedanken anzufreunden, dass ich gekündigt werde. Dass ich sehr gut war, in dem, was ich getan habe, dessen war ich mir bewusst. Auch, dass ich damit nicht aufhören wollte. Aber ich wusste ja, dass es so kommt. Ich musste also schauen, wo ich bleibe – mit meinem Glauben – und was das auch mit meinem Glauben macht. Ich bin sehr katholisch gewesen und gefühlt bin ich das immer noch. Mittlerweile trage ich überall ein, dass ich evangelisch bin, aber gefühlt bin ich das nicht. Am allerschlimmsten ist für mich aber, dass ich mein Zuhause verloren habe. Den Ort, der mir seit meiner frühesten Kindheit so viel gegeben und bedeutet hat.
Für meinen Sohn war es mir wichtig, dass er getauft wird, nicht so sehr die Konfession. Und mir selbst war es wichtig, das Eheversprechen an meine Frau auch in der Kirche, vor Gott zu sprechen. Wir haben dann evangelisch geheiratet mit einer tollen Pfarrerin, die mir in den letzten Jahren den Weg in die evangelische Kirche geebnet hat. Als mein Zuhause in der katholischen Kirche wegfiel, hat sie mir die Tür aufgemacht in die evangelische Kirche. Diese kann mir mein Zuhause aus der Kindheit nicht zurückgeben, aber wenigstens etwas auf dem Weg dahin sein.
Heute ist es mir sehr wichtig, meinen mittlerweile drei Söhnen den Weg zu Gott zu öffnen – unabhängig davon, was ich mit der Kirche als Institution erlebt habe. Und ihnen mit meinem Handeln meinen Glauben auch vorzuleben. Und das tun wir auch gemeinsam. Wäre die Situation eine andere, wären meine Söhne heute sicher katholisch. Es gibt so viele Dinge, wie die Messdienerarbeit zum Beispiel, die mir als Kind so wichtig waren. Das ist schon traurig, dass sie diese Erfahrung nicht machen können.
Ich bin selbst noch nicht in der Lage, ehrenamtlich wieder aktiv zu werden. Ich glaube, ich bin da noch im Trauerprozess. Schließlich habe ich nicht nur einen Job verloren. Sondern es war … – das war etwas, was man anders verarbeiten muss. Es ist ein Abschied. Und da bin ich noch nicht mit durch.
Was mich auch manchmal so ärgert, ist, dass ich von dieser Institution diskriminiert werde. Und ich kann mich nicht davon frei machen. Ich glaube, wenn ich wütender sein könnte, dann könnte ich das Ganze schneller verarbeiten, aber das kann ich nicht.
1Gekürzte und überarbeitete Fassung auf Grundlage des Interviews.
Familie
7. „Gott liebt ihn, ob getauft oder nicht!“
Carla Bieling, geb. 1974
Meine Frau habe ich in der katholischen Jugendarbeit kennengelernt. Wir waren drei Jahre befreundet, bevor wir uns ineinander verliebten.
Als Arbeitnehmerin beim Bistum musste ich meine Lebensform verschweigen. Das konnte ich nur, weil ich mich in meinem Team geoutet habe und somit dieser Raum nicht mehr durch ein Schweigen- und Verstellen-Müssen geprägt war, sondern durch Offenheit. In den darauffolgenden Wochen starteten wir unsere Teamsitzungen fortan mit einer Austauschrunde über unsere Glaubenserfahrungen. Schnell stellte sich dabei heraus, dass nicht nur ich an dieser Kirche litt.
Trotzdem konnte ich die Doppelmoral irgendwann nicht mehr ertragen. Ich entfernte mich innerlich immer mehr von dieser Kirche und hätte ich 2003 beim Ökumenischen Kirchentag (ÖKT) nicht das Netzwerk katholischer Lesben (NkaL) kennengelernt, hätte ich vermutlich meinen Glauben ganz verloren.
Im NkaL lernte ich ehemalige Ordensfrauen, aktive Gemeindereferentinnen, katholische Theologinnen und viele andere Frauen kennen und wir feierten einmal im Halbjahr gemeinsam Gottesdienst. In diesem durften alle Gefühle vorkommen; wir konnten authentisch sein, alles vor Gott tragen und uns so gegenseitig stärken und stützen. Wir waren nicht mehr allein mit dem Gefühl, von unserer Mutter (Kirche) nicht gewollt zu sein – aussortiert, verboten und abgestempelt. Wir haben viel miteinander geweint, aber auch gelacht. Es waren sehr intensive Gottesdienste, die wir reihum vorbereiteten und in denen unsere Fragen, Zweifel und leidvollen Erfahrungen stets einen Platz hatten. Und irgendeine hat immer für unsere Kirche gebetet, dass sie irgendwann alle ihre Kinder wieder annehmen kann – ohne in sündig und keusch zu unterteilen. Sie zu akzeptieren, wie sie sind – mit ihrem Wunsch verantwortliche Partnerschaften zu leben, ihren Glauben leben zu dürfen und offen zu ihrer Vielfalt zu stehen. Ohne Bewertungen, ohne Abwertungen.
Später gründeten meine Frau und ich eine Familie und wir bekamen zwei Söhne. Den Erstgeborenen ließen wir in seinem ersten Lebensjahr durch einen befreundeten Ordenspriester taufen.
Als das zweite Kind kam, wurde ich von meinem Arbeitgeber rausgeworfen – nicht rechtlich (ich habe einen Aufhebungsvertrag unterschrieben), aber sehr wohl emotional.
Der zweite Sohn wurde nicht getauft. Mit vier Operationen in seinen ersten anderthalb Lebensjahren hatten wir zunächst diese Sorgen. Anschließend kam er ins Trotzalter und einen Zweijährigen, der „Nein, ich will das nicht“ bei seiner Taufe ruft, das wollten wir auf keinen Fall.
Drei Jahre später näherten wir uns durch einen Priester mit einem innovativen Projekt ( Kirche am See ) der kath. Kirchengemeinde wieder etwas an. Dort bereitete jede Woche eine andere Gruppe den Gottesdienst vor und so bekamen auch Randgruppen eine Stimme. Und die Einladung Gottes an alle – ohne Selektion und Bewertung – fand wieder ein glaubwürdiges Gesicht! Doch dann wurde ein schon länger schwelender Konflikt im pastoralen Team durch die Versetzung des innovativen Priesters vom Bistum gelöst. Das zerstörte unser neugewonnenes Vertrauen wieder und der angedachte Tauftermin platzte.
Etwas später kam die Phase, in der unsere Söhne Gottesdienste stinklangweilig fanden, und wir sie irgendwann nicht mehr bewegen konnten, mitzukommen. Als beim Älteren die Erstkommunion anstand, war aber für ihn klar: „Das will ich auch.“
Und der Jüngere, der so manchen Weggottesdienst miterlebt hatte und Gefallen an den tollen Aktionen und dem Fest gefunden hatte, stimmt mit ein: Ja, das wolle er auch! Wir warteten ab, denn das Fest und die Geschenke sollten nicht seine einzige Motivation sein.
Ein Jahr später: Der Jüngere wünscht sich getauft zu werden, aber es klappt terminlich nicht auf Anhieb. Nach ein paar Wochen war es ihm dann auch nicht mehr so wichtig … In dem Alter geht das schnell.
Am ersten Tag des dritten Schuljahrs wurde das Thema Taufe dann wieder aktuell, und zwar durch die Fragen: „Bist du getauft? Willst du zur Erstkommunion?“ Da war für ihn ganz klar: „Mami, ich wusste bis jetzt gar nicht, warum ich so froh bin – jetzt weiß ich, warum ich so froh bin – ich freu mich so doll auf meine Taufe und auf meine Erstkommunion!“
Die Taufe haben wir dann innerhalb der nächsten vierzehn Tage festgemacht und in der Woche darauf eine sehr authentische Taufe gefeiert. Mit einem Kind, das von innen heraus gestrahlt hat! (Obwohl ich ihm im Vorfeld auch ganz klar gesagt habe, dass er sich nicht für uns taufen lassen muss. Gott liebt ihn so, wie er ist – ganz egal, ob er getauft ist oder nicht.) Es war wunderbar, das erleben zu dürfen.
Читать дальше