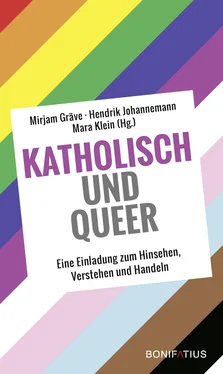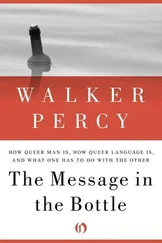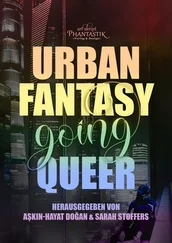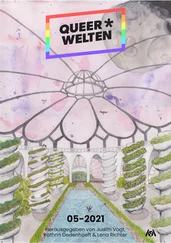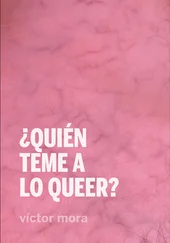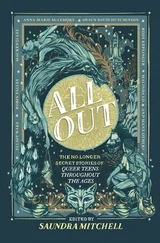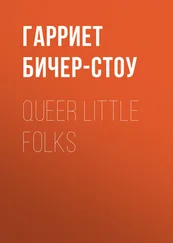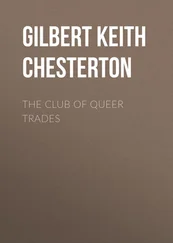Seit meinem Coming-out (vor mir selbst) hat sich meine innere Haltung diesbezüglich Schritt für Schritt gelöst und ich habe mehr Zutrauen in Gott gewinnen können. Das war kein Selbstläufer, es brauchte Zeit und ist bis heute nicht abgeschlossen. Zweifel, Angst und das Hadern mit mir selbst kommen immer mal wieder. Dennoch verstehe ich inzwischen klarer, dass die christlichen Texte und Lehren nicht eindeutig sind und immer wieder neu gedeutet und im Gebet erforscht werden müssen. Großartige Seelsorger leben dies vor und es sind beglückende Momente, wenn dies in Predigten, Gesprächen oder auch in Gesten deutlich wird.
Durch meine geistige Öffnung habe ich zwar zugleich ein entspannteres Verhältnis bezüglich offizieller kirchlicher Positionen und dem oft irritierenden Gebaren von mit der Kirche assoziierten Personen hinsichtlich Homosexualität und Co. gewonnen. Ich verteidige die Kirche zumeist gegen Kritik, weil ich daran glaube, dass das „Haus des Herrn“ weit ist und gerade dies die katholische Kirche stets ausgemacht hat. Ich muss aber auch gestehen, dass eine gewisse Abgeklärtheit dabei eine Rolle spielt, da ich um genügend Fälle gelebter Bigotterie in der Kirche weiß, in Priesterseminaren und Leitungspositionen, in Gemeinden und sonst wo (das gilt nicht bloß für Deutschland), sodass ich mir oft sage: Wenn die Kirche so lebt, dann kann mein kleines Leben keine schwerere Sünde darstellen und ich kann zumindest auf Gottes Gnade hoffen. Und das ist im Grunde eine betrübliche Haltung, die, denke ich, nicht selten ist: Das Volk Gottes wird sarkastisch oder zynisch angesichts einer Dogmatik, welche die Institution selbst in ihrer Praxis beständig konterkariert, sei es beim Zölibat, in der Frage des Umgangs mit Missbrauch oder in sonstigen Punkten. Nach dem Motto: Das „Bodenpersonal“ ist ja eh korrumpiert, ich suche mir eine Gemeinde, in der mir alles passt und ignoriere die Kirche beziehungsweise verlasse sie gleich ganz. Dieses „leben und leben lassen“ ist mehr Ausdruck von Bräsigkeit als von Toleranz oder gar Offenheit.
Als ebenso scheinheilig erweisen sich immer wieder konservative Reinigungsfantasien, etwa weil sie ihren eigenen Maßstäben nicht gerecht werden, oder weil sie Menschen gegeneinander ausspielen wollen, anstatt im Sinne des Glaubens bescheiden und barmherzig zu bleiben. Ich erwarte nicht, dass die Kirche beliebig wird und ihre Lehren einfach umwirft – im Gegenteil. Aber ich erwarte mehr Differenzierung und Bescheidenheit und eine Auseinandersetzung damit, was Katholizität in der Moderne bedeuten kann, anstatt gegen die Moderne. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen den Zugang zu letzten Fragen im Alltag nicht mehr finden und ihr oft nur indirekt verspürtes Sehnen nach Antworten in Lifestyle ertränken, entspräche dies einem missionarischen Geist.
Ich sorge mich zudem um jene Priester (es gibt genug von ihnen), die sich in der Seelsorge aufreiben, auch queeren Menschen Perspektiven eröffnen und darin – und nicht nur darin – von den Strukturen und der Lehre alleingelassen werden, während sie in der Öffentlichkeit dennoch als Personal einer „überkommenen Institution“ wahrgenommen werden. Sie sitzen zwischen allen Stühlen. Kein Wunder, dass so viel über Einsamkeit, Depression und sonstige seelische Verletzungen im Klerus geredet wird, nicht nur unter denjenigen Priestern, die (was ja oft kein Geheimnis ist) selbst schwul sind. Und kein Wunder, dass kaum jemand noch dieses Kreuz auf sich nehmen will. Das mag in anderen Gegenden der Welt (noch) anders sein, aber die Antwort, dass Europa eben „entgottet“ sei und man da nichts ändern könne, scheint mir ähnlich nihilistisch wie die banal atheistische Position, dass man religiöse Fragen endlich ad acta legen sollte. Der zur Schau gestellte Fundamentalismus ist sehr viel moderner, als viele „Tradis“ wahrhaben wollen, er spiegelt entgegengesetzte Extreme. Unser Glaube mag nicht von dieser Welt sein, die Kirche ist es. Dies zu leugnen, scheint mir bigott.
Schließlich: Das sechste Gebot wird – gerade von vermeintlich konservativen Kreisen – oft gefühlt zum ersten hochstilisiert und alles dreht sich dann um Sex, Gender (eher noch „Gendergaga“ – ohne Kenntnis der Überlegungen von Gendertheorien …) etc.
Ich selbst wurde als Teenager einmal in einem irischen Beichtstuhl gefragt, ob ich masturbiere, nachdem ich verklausuliert und verschämt von körperlichen Sünden sprach. Damals empfand ich das als geradezu erfrischend direkt und befreiend. Im Nachhinein zeigt es aber vielleicht auch, dass man sich mehr um die tiefer liegenden seelischen Zustände und Glaubensängste junger Menschen sorgen sollte, anstatt kompensatorische Reinheitsobsessionen zu bestärken. Was Körperlichkeit betrifft, könnte man beispielsweise lernen, dass viele Lehren völlig anderen Weltbildern entsprungen sind, die in ihrer Zeit plausibel und als von der Schrift gedeckt gewirkt haben mögen, aber sicher nicht den Kern der Heilslehre darstellen. Selbsthass zu nähren, unterminiert gelebten Glauben nur immer weiter.
Statt solcher Obsessionen mit sehr menschlichen, sehr zeitgebundenen und sehr wandelbaren Kategorien wünsche ich mir eine Kirche, die mehr auf die spirituellen Nöte in der heutigen Zeit schaut, für diese ein offenes Ohr hat und neue Formen des gelebten Glaubens dafür entwickelt (oder alte wiederbelebt).
Die Kirche sollte die Begegnung mit Gott anregen, der temporale Kategorien übersteigt und damit auch Fragen von Sexualität und Geschlecht, anstatt solche Fragen verdeckend vor die bloße Möglichkeit der Begegnung zu stellen. Ansonsten ist es kein Wunder, dass sie neben „Ersatzreligionen“ immer weniger Strahlkraft behält.
In einem jesuitischen Beichtstuhl wurde mir – im Kontrast zu der Erfahrung in Irland – einmal gesagt, eine Beziehung habe sich nicht so sehr über das Geschlecht zu definieren als dadurch, dass sie eine seelische Heimat bilden könne. Solches Einfühlungsvermögen wünsche ich mir.
10. „Gott hat Glück, dass ich ihn so trotzköpfig liebe“
Dr. theol. Robert Mucha, geb. 1987
Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann war da immer „Kirche“. Von klein auf gehörte sie für mich dazu und sollte mein Leben stark prägen. Die Beziehung zu Jesus Christus wurde für mich dann wirklich auch in der Erstkommunion spürbar: Ich sah es und sehe es auch rückblickend als tiefe Gnade und eigentlich höchstes Geschenk an, dass ich glauben kann. Glaube, Hoffnung und Liebe sind die göttlichen Tugenden. Doch ich merkte, dass gerade beim „Lieben“ immer auch noch eine andere Dimension bei mir dabei ist …
Die Faszination für das eigene Geschlecht, obwohl ich als Teenager auch schon einmal ein Mädchen geküsst habe, war am Ende größer. Und ich musste dies – auch wenn es gar keinen konkreten Anlass, keinen „Freund“ oder so gab – einfach jemandem offenbaren. Am 11. September 2001, ja, genau diesem Tag, rief ich meine Mutter vormittags bei der Arbeit an. Es musste raus, und zwar am Telefon. Am Nachmittag kam sie nach Hause. Die Twin Towers waren eingestürzt und ich erinnere mich noch gut an ihre Worte: „Das war ja ein Tag heute …“ Es war raus, aber damit war es gut. Ich wollte nicht weiter darüber sprechen. Ich war ja gerade erst 14 Jahre alt.
Die Kirche war für mich damals schon enorm wichtig. Auch die Meinung der Kirche über mich als Person. Ich beichtete es allerdings nicht; es gab ja auch nichts zu beichten: keine Handlungen dieser Art. Aber ich trug es in mir, dass irgendetwas schon nicht ganz so perfekt ist, wie es eigentlich sein müsste oder sollte.
Mit 18 Jahren dann – ich hatte bis dahin noch keine Erfahrungen sexueller Art gehabt, nur Schwärmereien – beschloss ich, den Weg zum Priestertum einzuschlagen. Ich war der festen Ansicht, dass ich es, da ich es nun schon so einfach und gut geschafft habe, auch weiter hinbekäme. Und ich dachte: „Ich setze einfach kein ,Initium‘, keinen verhängnisvollen Anfang, der eine Kettenreaktion in Gang bringt.“
Читать дальше