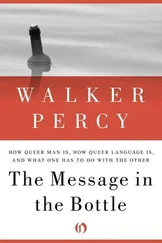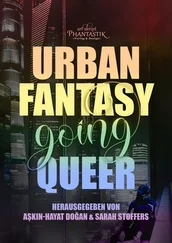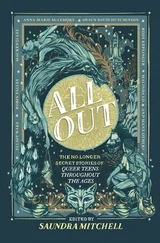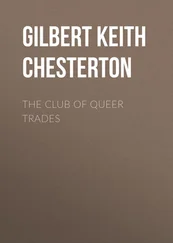Ich habe daraufhin die Kirche, die Menschen darin und den Glauben getrennt. Ich bin Christin und das bin ich nun als Teil der evangelischen Kirche. Meine Frau und ich haben kirchlich geheiratet, es war uns beiden wichtig, uns vor Gott und der Gemeinde zu verbinden.
Was bleibt?
Es bleibt der Schmerz, mich in über 20 Jahren in der Kirche nicht ganz eingebracht zu haben, es fehlte immer ein Teil von mir. Ich bin traurig, verletzt und wütend über die Erfahrungen, die ich mit einzelnen Menschen im Bistum gemacht habe. Und ich bin entsetzt über die Schere, die sich in der Kirche auftut zwischen der Lehre und dem, wie die Menschen konkret leben. Ich bin wütend darüber, dass die Kirche mir vorschreiben will, wie ich zu leben habe und dass dieselben Menschen, die dies zum Teil von der Kanzel verkündigen, genauso „sündig“ leben!
Was fehlt?
Mir fehlt eine katholische Kirche, die authentisch ist. Mir fehlt eine Kirche, die im Hier und Jetzt lebt und das hier Beschriebene als Realität wahrnimmt. Ich will eine Kirche, die die Männermacht aufgibt und Menschen nach ihren Gottesgaben einstellt und bezahlt. Und ich wünsche mir eine Kirche, die ihre dunklen Seiten offenlegt und über ihren Missbrauch spricht.
4. „Zwischen Geringschätzung und Wertschätzung“
Gerhard Wachinger, geb. 1966
Aufgewachsen bin ich im Münchner Umland. Dort habe ich wiederholt eine homophobe Welt erlebt. Ich kann mich erinnern, dass ich in der vierten Klasse zu einem Mitschüler zärtlich war. Da wurde ich vor der Klasse bloßgestellt. Dass man nicht schwul sein darf, war also nicht nur in der Kirche so, sondern in der ganzen Gesellschaft. Später dann nach München zu ziehen und dort zu studieren, war für einen 20-Jährigen eine vielversprechende Aussicht.
Im Priesterseminar habe ich viel unterschwellige Homosexualität erlebt, die sich mir aber oft erst in der Reflexion erschloss. Explizit habe ich nichts erlebt. Mein Coming-out habe ich dann zum Anlass genommen, das Seminar zu verlassen und erst im Zivildienst, anschließend im Hauptstudium meine Identität zu entwickeln. Nachdem dies vorläufig geklärt war, habe ich die Ausbildung zum Pastoralassistenten abgeschlossen. Und während dieser erhielt ich bereits vereinzelt Unterstützung, zum Beispiel vom Ausbildungsleiter, der mich bestärkt hat, mit meinem Weg weiterzumachen. Der christliche Glaube hat mich immer in meinem „So-Sein“ bestärkt; homophobe Äußerungen hingegen haben mich nie vom Gegenteil überzeugt.
In den ersten Dienstjahren war es mir sehr wichtig zu spüren, dass ich auch als schwuler Mann willkommen bin. Deshalb habe ich Signale ausgesendet, die manche richtig gedeutet haben. Zum Beispiel hat ein Jugendlicher sich mir gegenüber geoutet, weil er sich von mir verstanden fühlte. Gleichzeitig wurde mir klarer, dass ich im kirchlichen Dienst nicht die Anerkennung finde, die ich brauchte. Ich musste und wollte sie mir dort suchen, wo dies ohne Verletzungen möglich war. Es brauchte integrierende Erfahrungen, die mich überhaupt im kirchlichen Dienst gehalten haben.
Seit meiner Aussendung 1994 bis zu ihrer Auflösung etwa sechzehn Jahre später war ich in einer Gruppe schwuler pastoraler Mitarbeiter, größtenteils Priester. Für mich war es sehr gut, dort zu spüren, wie das Ganze geht, welche Grenzen und Nöte es gibt. Das war immens wichtig, ein Teil dieser Gruppe zu sein. Ich habe die großen Ängste der Priester gespürt, einige sind sogar psychisch krank geworden. Mich hingegen hat diese Erfahrung ermutigt, einen queerGottesdienst zu gründen.
Im August 2000 war ich begeistert von der Queergemeinde in Münster und suchte bald darauf Mitstreiter für ein Projekt in München. Nach einigem Anklopfen wurde ich fündig, und so bereiteten wir 2001/02 vor, was im März 2002 zum ersten queerGottesdienst in München führte.
Dass anfangs um die 60 Leute, größtenteils schwule Männer, monatlich an den Stadtrand pilgerten, um an einer Abendmesse teilzunehmen, obwohl uns die Möglichkeiten fehlten, sie groß zu bewerben, war überaus ermutigend. Daneben war für mich die Erfahrung sehr wertvoll, wie die Kirchenleitung mit dem Thema umging. Statt Verboten gab es Gespräche mit Vertretern der Bistumsleitung, die ohne diesen konkreten Anlass wohl mit mir und mit uns nie stattgefunden hätten. Ich persönlich habe da eine Wertschätzung erlebt, die manches von der erlittenen Geringschätzung kompensiert hat.
Als nach sieben Jahren der queerGottesdienst infolge des räumlichen Zusammenlegens mit einer homophoben Nachbargemeinde aus dem Stadtteil vertrieben wurde, erlebten wir den Umzug in die Innenstadt als eine Aufwertung unseres Projekts. Die Gastfreundschaft in St. Paul und die „Approbation“ des Namens queerGottesdienst sind weitere Schritte zur Integration von LSBTI-Menschen in der Kirche.
Mittlerweile fühle ich mich als schwuler Mitarbeiter schon fast akzeptiert. Ich fremdele selbst noch etwas damit, wie sehr ich meine geschlechtliche Identität zum Thema machen soll. Noch immer fehlen mir Vorbilder. Ich schwanke zwischen „das ist mir zu persönlich“ und „alle dürfen es wissen“. So gehe ich einen etwas krummen Weg, von dem ich noch nicht recht weiß, was er noch bringen wird. Diese Unsicherheit ist aber eine wichtige Triebfeder, weiterzuarbeiten an einer Kirche, in der das Schwulsein zwar nicht „normal“, aber akzeptiert ist.
5. „Ich weiß einfach, dass Gott mich so liebt“
Eva, geb. 1977
Ich habe immer viel Glück gehabt. Meine Eltern haben mir das Gefühl gegeben, dass sie mich lieben, egal, wie gut ich in der Schule bin, egal, was für Spielkamerad*innen ich nach Hause bringe, egal, wie ich meine Freizeit verbringe, egal, welche Ausbildung ich wähle, … Das hat sicherlich meine Gottesbeziehung am meisten beeinflusst. Ich habe bis heute das Gefühl, dass Gott den Menschen liebt, egal, was er tut (solange er niemandem schadet) und dass Gott sich wünscht, dass jeder Mensch glücklich ist, mit sich glücklich ist.
Bis zum sechsten Schuljahr war ich auf katholischen Schulen; weniger weil mein Elternhaus besonders religiös ist, sondern weil es die Schulen mit dem kürzesten Schulweg waren.
In der 5. Klasse wurde das Wort „schwul“ von Mitschülern als Schimpfwort benutzt. Das war das erste Mal, dass ich das Wort gehört habe. Meine Eltern haben mir in Ruhe die Begriffe heterosexuell, lesbisch, schwul und bi erklärt und zwar so, dass ich es als „normal“ verstand, eins davon zu sein. Die Klassenlehrerin hat ähnlich gesprochen. Damals habe ich mir noch keine großen Gedanken über meine Sexualität gemacht.
In Klasse 11 hatte ich dann evangelischen Religionsunterricht. Bei uns wurde nicht immer streng nach Konfessionen getrennt. Eine Unterrichtseinheit beschäftigte sich mit Liebe und Partnerschaft. In einer Doppelstunde hatte die Lehrerin junge Leute von der HuK und der LuK ( Homosexuelle und Kirche bzw. Lesben und Kirche ) eingeladen. Zu dem Zeitpunkt war mir schon klar, dass ich lesbisch bin. Ich fand die Stunde sehr positiv.
Von der 4. Klasse an war ich Messdienerin und das bis zum Abitur. Ein Mitministrant (ein Jahr älter) war der erste homosexuelle Mensch, den ich persönlich kannte (abgesehen von den Buchhändlerinnen im Frauenbuchladen, die ich eher nur vom Sehen kannte). Trotzdem habe ich mich ihm gegenüber nicht wirklich geoutet. Ich wollte mit meinem Outing warten, bis ich meine erste Freundin hatte. Das hat bedauerlicherweise etwas länger gedauert. Aber indirekt habe ich mich schon geoutet, da ich beispielsweise ins schwule Café ging. Es war aber nicht wirklich Thema. Durch meinen Mitministranten habe ich Homosexualität weiter als etwas Normales kennengelernt.
Ein für mich und meine Beziehung zum Thema Homosexualität prägendes Ereignis war der Fastenbrief des Bischofs. (Ich denke, es war etwa 1994, vielleicht aber auch nicht der Fastenbrief, vielleicht auch nicht vom Bischof, aber irgendetwas in der Art). In diesem wurde Homosexualität (zumindest ihr Ausleben) als schlecht und nicht den katholischen Werten entsprechend bezeichnet. Das Schreiben sollte vom Pfarrer in der Messe vorgelesen werden. Ich hatte schon vorher von seinem Inhalt mitbekommen und mir war zu dem Zeitpunkt bewusst, dass die vorherrschende katholische Lehre Homosexualität ablehnt. Das passte natürlich überhaupt nicht zu meinem Verständnis, dass Homosexualität ganz normal ist. Ich war an dem Sonntag Messdienerin und hatte mir vorgenommen, dass das mein Ende mit der katholischen Kirche bedeuten würde, sollte der Pfarrer den Brief vorlesen und die Meinung des Bischofs vertreten. Mein Plan sah vor, dass dies mein letzter Einsatz als Messdienerin sein und dass ich der Kirche den Rücken zuwenden würde.
Читать дальше