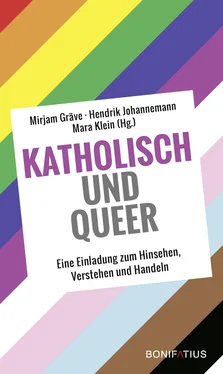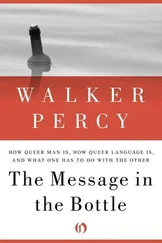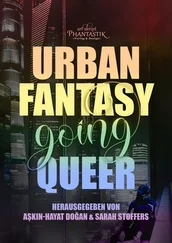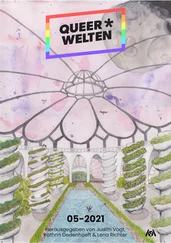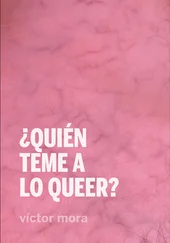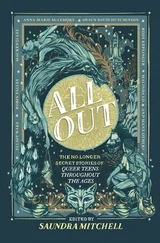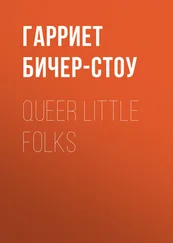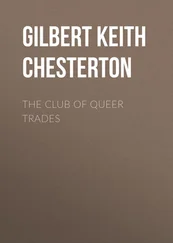Dann ließ ich meine Kirche los. Ich ließ alle Schilde fallen. Ich ließ die Erwartungen der Menschen los. Ich fuhr alle Ansprüche herunter, die ich an mich selbst hatte, bis zu den Grundfesten meines Glaubens. Dort fand ich die Sendung, die ich in mir trage: den Menschen Gutes zu tun.
Ich betete, ließ alle Pläne ziehen und fand am Tiefpunkt meines Lebens einen neuen Weg. Und ich versprach G*tt: Wenn das der Mensch ist, der ich sein muss, um Gutes in der Welt tun zu können, dann werde ich dieser Mensch sein, auch wenn ich den Weg, den ich betrete, nicht kenne, und wenn ich ihn ohne meine Kirche gehen muss.
Ich wusste, ich würde keine Hilfestellung haben, denn dieser Weg war nicht vorbereitet. Und auch, dass ich G*tt zwischendurch missverstehen könnte, aber es gab nichts außer meiner Vereinbarung mit G*tt.
Ich versuche jetzt, stets offen zu bleiben. Nachzufragen. Hinzuhören. Damit eines Tages, wenn ich vor G*tt stehe, mein Gewissen klar ist.
Ich bin jetzt im Reinen mit G*tt.
Ich bin verletzlich, weil ich aus meiner Kirche herausgefallen bin und weil die mittlerweile vielen Menschen, die Kirche mit mir zusammen sein wollen, so oft nicht sichtbar sind.
Ich habe keinen sicheren Platz in meiner Kirche. Ich bin oft dort und solange ich nützlich erscheine oder namenlos bin, bin ich geduldet. Aber im Angesicht lehramtlicher Kirche, wenn sie diese Seite von sich hervorkehrt, hört spontan ein jedes Mal meine Existenz auf. Ich entschwinde mir. Dann muss ich hinausgehen und mich suchen. Vielleicht komme ich noch mal zurück.
Mir wird nicht getraut. Schon nicht bei meiner Existenz, wo denn dann? Manchmal höre ich auf zu sprechen.
Doch selbst, wenn ich mich ganz vergrabe, muss ich doch immer wieder hervorkommen. Denn G*tt hat so viele wunderbare queere Menschen gemacht. Und ich will nicht, dass davon auch nur eine Person ihren Glauben verlieren muss, weil wir so kleingläubig sind und kein Vertrauen in G*tt haben.
Katholisches Arbeits(un)recht
3. „Meine Seele hat gestreikt“
Manuela Sabozin-Oberem, geb. 1969
Ich bin 51 Jahre alt und lebe gemeinsam mit meiner Frau in Bochum. Ich wurde als Kind katholisch getauft und bin zur Erstkommunion gegangen, obwohl ich in einer kirchenfremden Familie aufgewachsen bin. Das „machte man eben so“.
Später wurde ich dann noch als junge Erwachsene gefirmt, weil ich seinerzeit als Jugendliche aus dem Firmunterricht geflogen bin. Meine Firmung „benötigte“ ich aber für mein Studium als Religionspädagogin im Essener Seminar für das Bistum Essen.
Ich beschreibe meinen Werdegang so genau, da ich in der Reflexion festgestellt habe, dass mein Glaube groß war und ist, meine Zugehörigkeit zur katholischen Kirche aber eine eher zufällige darstellt.
Nach dem Studium habe ich dann 20 Jahre als Gemeindereferentin gearbeitet, zuerst in der Gemeinde und dann als Krankenhausseelsorgerin.
Beruflich war ich am richtigen Ort angekommen!
Ich habe mich immer in Frauen verliebt. Das hat sich immer gut und richtig angefühlt. Im Studium, Ende der 80er-Jahre, wurde ich dann mit der katholischen Morallehre konfrontiert. Überall habe ich nachgelesen, was die Kirche zu Homosexualität sagt. Da fing auch der Schmerz an. Ein Schmerz, über den ich mit niemandem sprechen konnte, denn schnell habe ich verstanden: Über manche Dinge spricht man am besten nicht in der katholischen Kirche.
Ich habe es nicht miteinander vereinen können: auf der einen Seite die Lehre der Kirche. Die Kirche, die mich als Angestellte beschäftigte, meine Arbeit für gut befand und für mich ein Zuhause und eine Heimat geworden war. Und auf der anderen Seite meine Identität, meine Gefühle und Gedanken. Ich habe mich nicht schuldig und sündig gefühlt, weil ich die war, die ich bin. Ich fühlte mich von Gott so gewollt und geliebt. Dieser Schmerz war immer da, aber oft im Hintergrund des Alltagsrauschens.
Ich hatte mich „gut“ eingerichtet, mein Doppelleben zu führen. In der Gemeinde war ich die Seelsorgerin und zu Hause die Partnerin.
Der Wendepunkt war meine Verabschiedung aus der Gemeinde. Ein großes Fest, ein großer Gottesdienst. Es war fast perfekt, aber eben nur fast. Denn meine Frau und eine ihrer Töchter saßen nicht da, wo sie hingehörten: neben mir! Sie saßen ein paar Reihen hinter mir und ab diesem Moment brach der Schmerz sich Bahn.
Fast täglich stellte ich mir selbst die Frage: Warum ist das so? Warum kann ich nicht so sein, wie ich bin und meinen Beruf ausüben? Von da an hatte ich auch eine große Angst, geoutet zu werden und meinen Beruf zu verlieren. Mein „nicht kirchliches“ Umfeld konnte diese Angst kaum verstehen. „Was ist denn daran so schlimm, dass du lesbisch bist?“ – „Hat doch den Arbeitgeber nichts anzugehen!“ Doch in meinem beruflichen Umfeld, wo ich nicht geoutet war, konnte ich über diese Angst nicht sprechen.
In den darauffolgenden Jahren fand ich einige Kolleginnen und Mitarbeiterinnen, denen ich mich anvertrauen konnte. Sie nahmen mich an; es ging gut. Die Angst blieb trotzdem und vor jedem Gespräch wuchs sie ins Unermessliche. Was ist, wenn die Kollegin mich nun doch beim Bischof anzeigt? Und jede Äußerung der Kirche über Homosexualität traf mich bis ins Innerste!
In vielen Gottesdiensten saß ich und dachte, was mache ich, wenn der Priester etwas gegen Homosexualität in seiner Predigt sagt? Ich träumte davon, dann aufzustehen und allen zu sagen, wer ich bin.
Mein Heimathafen war und ist seit 1998 das Netzwerk katholischer Lesben (NkaL)! Hier lernte ich Frauen kennen, die lesbisch und gläubig sind. Das, was nicht miteinander vereinbar schien, ging doch zusammen, und es war gut so! Ich traf dort andere Frauen, die die gleichen Ängste und Nöte kannten, die ich jahrelang erlebt hatte! Ich wurde aufgefangen und konnte auch andere Frauen auffangen.
Beim NkaL und auch in den anderen christlichen schwullesbischen Netzwerken wird gelebt, was uns ausmacht: Wir sind christliche gleichgeschlechtlich liebende Menschen und wir sind Kinder Gottes!
Mit den Jahren und meiner Tätigkeit im Bistum lernte ich immer mehr Menschen kennen. Auch erfuhr ich mehr interne Informationen. Ich lernte beispielsweise Priester kennen, die eine Freundin hatten. Doch viel öfter hatten Priester einen Freund.
Das war der Punkt, an dem ich mit einer anderen Realität meiner Identität konfrontiert wurde: Ich bin eine Frau!
Schon bei meiner Sendungsfeier 1996 war mir bewusst, bereits am Ende meiner beruflichen Karriere angekommen zu sein. Über mir war die gläserne Decke des geweihten Amtes.
Viele denken, dass homosexuelle Menschen solidarisch sind. Wir Homos auf der einen und drüben auf der anderen Seite die Heteros. Ja, es gibt sie. Doch die Solidarität, die ich im NkaL und in dessen Umfeld erlebt habe, erlebte ich oft nicht, wenn es um schwule Priester ging. Diese waren zuerst Priester und genossen damit ihre Privilegien. Ihr Schwul-Sein, das zum Teil sehr offen gelebt wurde, wurde von „den Oberen“ toleriert.
Meine Zweifel an der katholischen Kirche wurden immer größer: Warum hatte ich fast täglich Angst, dass meine Liebe zu meiner Frau entdeckt wird und ich meinen geliebten Beruf verliere, während es schwulen Priestern möglich war, so sicher zu leben? Warum bin ich als Frau in der katholischen Kirche weniger wert als ein Mann?
Es war ein langer Prozess. Über 20 Jahre hat er gedauert. Dann hat meine Seele gestreikt: Ich wurde krank.
Nach langen Monaten mit Therapie und Klinikaufenthalt wurde mir klar: Ich will leben, und zwar so, wie Gott mich erschaffen hat: als Frau, die eine Frau liebt. Das bedeutete für mich, die katholische Kirche zu verlassen, meinen Beruf aufzugeben und auszutreten. In dieser Zeit hatte ich existenzielle Ängste: Angst vor der Zukunft und vor allem Angst, Gott zu verlieren.
Читать дальше