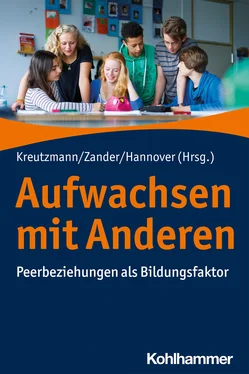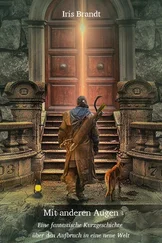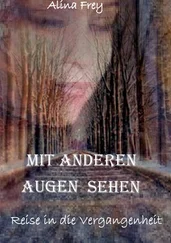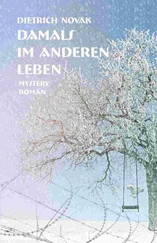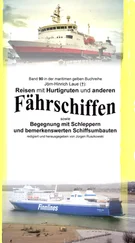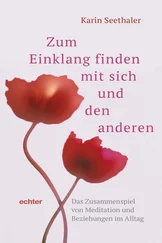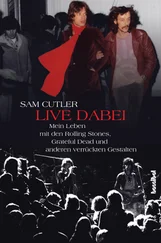Aufwachsen mit Anderen
Здесь есть возможность читать онлайн «Aufwachsen mit Anderen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Aufwachsen mit Anderen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aufwachsen mit Anderen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Aufwachsen mit Anderen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Aufwachsen mit Anderen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Aufwachsen mit Anderen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
2.2 Die Messung von Peerbeziehungen mittels sozialer Netzwerkanalyse
Eine Alternative zur klassischen Fragebogenmethode mit dem Potenzial einer objektiven Messung von Peerbeziehungen ist die soziale Netzwerkanalyse (SNA), auch bekannt unter dem Begriff Soziometrie 2 (Moreno, 1934). Obgleich die SNA erst vor wenigen Jahren in den Fokus der Bildungsforschung rückte (Herz, 2014; Moolenar, 2010; Zander, 2013), ist sie in anderen Bereichen der Sozialwissenschaften schon länger prominent vertreten (Knoke & Yang, 2008; Moolenar, 2010) und verfügt daher über ein breit ausdifferenziertes Methodenrepertoire, das in den nachfolgenden Abschnitten skizziert werden soll.
2.2.1 Netzwerktypen und Datenerhebung
In einem typischen Instrument zur Erfassung eines sozialen Netzwerkes werden die Lernenden gebeten, ihre besten Freundinnen und Freunde anzugeben (vgl. Knoke & Yang, 2008). Die Lernenden erhalten dazu eine Liste aller Mitglieder der Klasse, auf der sie diejenigen Peers ankreuzen können, mit denen sie befreundet sind. Alternativ werden sie gebeten, die Namen ihrer Freunde oder Freundinnen in der Klasse aus dem Gedächtnis heraus aufzuschreiben. Der Vorteil, der sich aus der Vorlage einer Liste aller Mitglieder eines Netzwerks ergibt, liegt in einer stärkeren kognitiven Auseinandersetzung mit dem Material (Marsden, 2011), wodurch verhindert wird, dass Lernende bei der Beantwortung wichtige Verbindungen vergessen (Borgatti, Everett & Johnson, 2013). Bei jüngeren Befragten wird häufig das Ankreuzen oder Aufschreiben der Namen durch ein Kurzinterview ersetzt (z. B. bei Krull, Wilbert & Hennemann, 2014).
Neben sogenannten affektiven Netzwerken (z. B. Freundschaften, Sympathie, Beliebtheit) können auf diese Weise auch sogenannte kognitiv-instrumentelle Netzwerke von Lernenden erfragt werden (z. B. Hilfe und Austausch). Welcher dieser beiden Netzwerktypen adressiert wird, hängt von der zu beantwortenden Ausgangsfrage ab (Zander, Kreutzmann & Hannover, 2017; Zander, 2013). Für die Erfassung eines kognitiv-instrumentellen Netzwerktyps wäre beispielsweise die Frage »Wen fragst du bei deinen Hausaufgaben um Hilfe?« angemessen, wohingegen die Frage »Wen lädst du zu deiner Geburtstagsfeier ein?« auf ein affektives Netzwerk abzielt. Vor allem in Hinblick auf affektive Netzwerke ist nach wie vor umstritten, ob bei der Erhebung neben Positivnennungen (z. B. »Wen magst du?«) auch negative Nominationen (»Wen magst du nicht?«) erfragt werden sollten (Frederickson & Furnham, 2001). Der Vorwurf an dieser Stelle lautet, dass die Abfrage negativer Nominationen wie eine psychologische Intervention wirke und unmerklich vorhandene Antipathien durch die Fragestellung erst sichtbar gemacht würden oder eine Norm entstünde, dass es angemessen sei, Peers in der Klasse explizit abzulehnen (Bell-Dolan, Foster & Sikora, 1989; Cillessen, 2009; Rubin, Coplan et al., 2011). Dies allein ist ein gutes Argument dafür, in pädagogischen Kontexten lediglich positive Nennungen zu erfragen. Andererseits zeigen verschiedene Forschungsarbeiten (Herz, 2014; Veenstra et al., 2010), dass es gerade die negativen Nominationen sind, die ein besonders aufschlussreiches Bild über die Peerbeziehungen liefern. Veenstra et al. (2010) konnten beispielsweise anhand der gleichzeitigen Betrachtung von positiven und negativen Nominationen zeigen, dass die geringe Eingebundenheit in ein Freundschaftsnetzwerk als alleiniges Merkmal nicht vorhersagt, ob Lernende zum Ziel von Bullying werden. Erst ein zusätzlicher hoher Grad an Ablehnung, also negativen Nominationen, machte Lernende vulnerabel für Bullying.
Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von Netzwerkdaten liegt darin, ob bei der Abfrage gerichtete (Englisch: directed) oder ungerichtete (Englisch: undirected) Beziehungen erfasst werden. In gerichteten Netzwerken (z. B. Freundschafts- oder Hilfenetzwerke) ist ausschlaggebend, von welcher Person eine Nominierung ausgeht. So kann beispielsweise aus der Tatsache, dass Person A die Person B als Freund oder Freundin genannt hat, nicht geschlossen werden, dass auch Person B die Person A als Freund oder Freundin nominiert. In ungerichteten Netzwerken hingegen wird lediglich erfasst, ob zwischen Person A und Person B überhaupt eine Verbindung existiert oder nicht. Bittet man beispielsweise die Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs oder der gesamten Schule darum, alle anderen Lernenden anzugeben, mit denen sie im Nachmittagsangebot der Schule eine Arbeitsgemeinschaft besuchen, erhält man als Ergebnis ein sogenanntes Co-Membership-Netzwerk (Marin & Wellmann, 2011). Eine auf diese Weise festgestellte (ungerichtete) Beziehung zwischen zwei Lernenden gibt an, dass sich beide im Rahmen derselben Arbeitsgemeinschaft begegnen. Eine Unterscheidung von gerichteten und ungerichteten Beziehungen ist auch deshalb wichtig, weil einige Auswertungsmethoden für Netzwerkdaten nur für einen der beiden Netzwerktypen definiert sind. Die nachfolgend beschriebenen Indizes In- und Outdegree können beispielsweise nur in gerichteten Netzwerken, nicht jedoch in ungerichteten Netzwerken berechnet werden. Unabhängig davon, ob ungerichtete oder gerichtete Verbindungen erfasst werden, liegt die Stärke der SNA insbesondere in der Gegenüberstellung und Kombination von Nominierungen. Werden beispielsweise zwei Lernende zum Bestehen einer Beziehung befragt und deren Nominationen miteinander kombiniert, erhöht dies sowohl die Verlässlichkeit der Messung als auch letztlich deren Objektivität. Wie das Beispiel zu den sogenannten Indegree und Outdegree in Abschnitt »Indizes auf Personen- und Gruppenebene« zeigt, kann die Gegenüberstellung von Nominationen darüber hinaus Hinweise auf diskrepante Wahrnehmungen von Lernenden geben und auf Erfahrungen von Exklusion und Ausschluss im Klassenkontext aufmerksam machen.
2.2.2 Datenauswertung
Für die Auswertung der Netzwerkdaten kommen sowohl beschreibend-darstellende Verfahren der deskriptiven Statistik, die Netzwerkvisualisierung, als auch hypothesenprüfende Ansätze der Inferenzstatistik zum Einsatz. In der Praxis werden diese Ansätze häufig kombiniert eingesetzt, indem soziale Netzwerke zunächst mit deskriptiven Indizes beschrieben und zusammengefasst und anschließend mittels Methoden der Inferenzstatistik (t-Test, lineare Regression, usw.) ausgewertet werden (vgl. z. B. Ahn, Garandeau & Rodkin, 2010).
Indizes auf Personen- und Gruppenebene
Die Berechnung von Zentralitätsmaßen (Englisch: degrees) in einem sozialen Netzwerk gehört meist zu den ersten Schritten einer SNA (O’Malley & Marsden, 2008). Auf der Personenebene gibt der Degree die Anzahl der Verbindungen einer Person in einem Netzwerk an. Im Fall gerichteter Netzwerke werden hierzu zwei separate Maße, die In- und Outdegrees, berechnet. Der Indegree einer Person gibt die Summe der erhaltenen Nominierungen an. Im Fall von Peerbeziehungen wird der Indegree häufig als Maß der Beliebtheit interpretiert, wobei eine Person umso beliebter ist, je höher ihr Indegree im Vergleich zu anderen Mitgliedern des Netzwerkes ausfällt (vgl. Zander, Kreutzmann & Hannover, 2017). Der Outdegree wiederum kann als Maß der Aktivität oder Kontaktfreudigkeit einer Person interpretiert werden, denn er gibt die Summe der Beziehungen einer Person an, die auf andere Personen im Netzwerk gerichtet sind. Um die Degrees sowie die In- und Outdegrees zwischen verschieden großen Netzwerken vergleichen zu können, werden sie üblicherweise an der Anzahl der theoretisch möglichen Wahlen innerhalb eines Netzwerks normiert, d. h. durch diesen Wert geteilt. In einer Schulklasse errechnet sich die Anzahl dieser Wahlmöglichkeiten mit N Klasse–1, da eine Selbstnominierung nicht gezählt wird. In gerichteten Netzwerken ist neben der Berechnung von In- und Outdegrees häufig auch die Anzahl der auf Gegenseitigkeit basierenden Nominierungen interessant, d. h. die Zahl der eigenen ausgehenden Wahlen, die von den anderen Personen im Netzwerk erwidert werden (Fuhse, 2016; O’Malley & Marsden, 2008). Ein deutliches Missverhältnis zwischen beiden Werten kann ein Hinweis sein, dass die Situation des Betroffenen genauer angeschaut werden sollte (Henke et al., 2017). Ist die Zahl der Outdegrees eines Kindes z. B. beträchtlich höher als die Zahl seiner Indegrees, dann besteht seitens dieses Kindes möglicherweise ein häufig unerwiderter Wunsch nach Zugehörigkeit zu anderen im sozialen Netzwerk. Je nach Klassen- und Gruppensituation kann diese Diskrepanz bedeuten, dass das Kind von sozialem Ausschluss bedroht ist. In einem solchen Fall sollten durch die Lehrkraft soziale Normen adressiert und mit den Lernenden verhandelt werden, um sozialen Ausschluss im Klassenkontext zu verhindern. Die zuvor genannten Maße können auch jenseits der Personenebene auf der Ebene von Gruppen (z. B. Jungen und Mädchen einer Klasse) oder des gesamten Netzwerkes (z. B. Schulklasse) berechnet werden, wobei man in diesem Fall von der Dichte (Englisch: density) der Gruppe oder des Netzwerkes spricht (Borgatti, Everett & Johnson, 2013). Die Dichte eines Netzwerkes ist dann umso höher, je mehr potenzielle Verbindungen von den Mitgliedern des Netzwerkes auch wirklich realisiert werden. Einige Studien konnten zeigen, dass in Peernetzwerken mit höherer Dichte ein positives Klassenklima herrscht und die Lernenden Bullying-assoziiertes Verhalten weniger stark akzeptieren (Ahn, Garandeau & Rodkin, 2010).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Aufwachsen mit Anderen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Aufwachsen mit Anderen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Aufwachsen mit Anderen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.