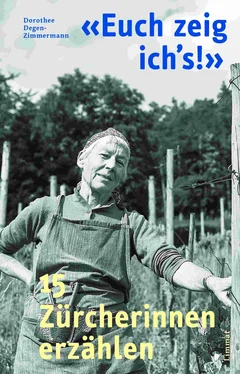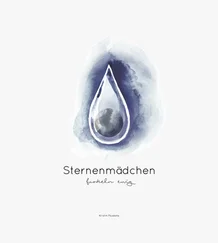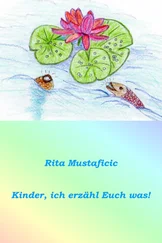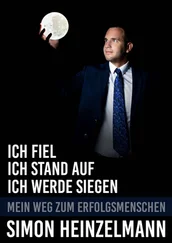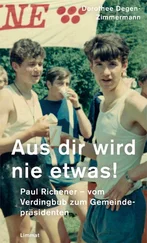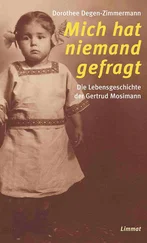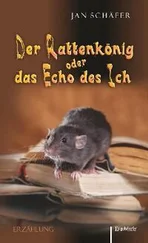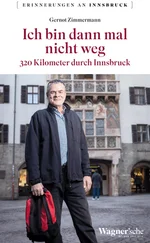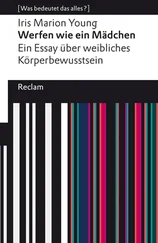Die Unternehmensführung bleibt eine Herausforderung. Der technische Wandel im Musiksektor ist seit mehr als hundert Jahren enorm. Schon im frühen 20. Jahrhundert löste eine Novität die andere ab, Phonographen, Reproduktionsklaviere, Spielautomaten, Grammophone kamen in Mode und sanken schon bald wieder in Vergessenheit. Das ist bis heute nicht anders. «Als ich anfing, gab es noch keine CDS. Plötzlich kamen sie auf, und es galt, schnell zu reagieren, Platz zu schaffen, die Gestelle auszuwechseln. Man muss sich immer mit der Entwicklung des Marktes befassen, neben der Tradition und der Liebe zur alten Musik offen sein für Neues, für elektronische Tasteninstrumente, E-Gitarren, Perkussion. Hinzu kommt, dass die vielen Mietinstrumente und das grosse Lager an Meisterinstrumenten viel Kapital binden. Und schliesslich muss man Geld verdienen, das ist das A und O. In dieser Branche ist das sehr anspruchsvoll.»
Doch noch eine eigene Familie
Damit hat Erika Hug nicht gerechnet. Dieser Mann ist offen, gewinnend, von entwaffnender Unbeschwertheit, «eine absolut aussergewöhnliche Person und das pure Gegenteil meines introvertierten Vaters». Sie lernt Eckard Harke 1986 auf einer Tagung des Fachverbands Musikinstrumente in Deutschland kennen, er leitet drei Musikfachgeschäfte in Detmold und Paderborn. Als Erika Hug und Eckard Harke 1989 heiraten, ist das nicht nur ein privates Glück, sondern auch für die Firma ein grosser Gewinn. Denn er kennt das Handwerk von Grund auf und ist ein erfahrener Musikfachhändler. «Solche Leute sind dünn gesät. Plötzlich hatte ich einen super Fachmann, das hat uns wahnsinnig stark gemacht.» Sein eigenes Geschäft übergibt er seinen Söhnen aus erster Ehe.
Und es geht weiter mit dem unverhofften Glück, Erika Hug wird mit 43 Mutter. «Ich hatte mir immer Kinder gewünscht, aber einfach keinen guten Mann gefunden, ich hatte ja gar keine Zeit dazu.» Rechtzeitig vor der Ankunft des Babys zieht die Familie in eine geräumige Wohnung in Zumikon. «Meine bisherige Wohnung war zu klein, und in der Stadt fand ich nichts Passendes. Ich muss Ruhe haben und einen Ausblick. Später mieteten wir ein Haus in Küsnacht mit einem wunderbaren Garten, ich bin ein Mensch der Erde.»
Was doch so ein kleines Kind an Neuem, Überraschendem mitbringt, «phänomenal, der Hammer, eine wahnsinnige Motivation! Julian war ja so ein lustiger Bub. Mit ihm habe ich nach Jahrzehnten wieder angefangen zu singen, ich musste mich erst wieder in die Kinderlieder hineinfinden. Und manchmal haben wir zusammen Musik gemacht, mein Mann spielt Klavier und Julian hatte eine Ukulele und eine kleine Geige.» Betreuung, Kindergarten, Schule verlangen Aufmerksamkeit. Erika Hug ist der Meinung, dass der Staat sich gut – besser! – um die Kinder kümmern sollte. «Ein Staatsgebilde, in dem die Frauen unterdrückt oder marginalisiert werden, kann sich nicht optimal entwickeln.» Tagesschulen seien das Gebot der Stunde, findet sie, und wenn der Staat sich drücke, müsse man halt von privater Seite die Initiative ergreifen. «Ich wollte in der Innenstadt mit Jelmoli und andern Geschäften einen Hort organisieren. Aber die haben mich ausgelacht, das sei nicht ihr Problem. Und in der Wohngemeinde stemmten sich ausgerechnet die Frauen dagegen. Richtig giftig waren die! Gott sei Dank konnte ich mir ein Kindermädchen und eine Haushälterin leisten. So war immer jemand da, wenn Julian von der Schule heimkam.»
Kinder und Musik zusammenbringen
Lange bevor Erika Hug selber Mutter wird, hat sie schon die Kinder im Blick. Gerade leicht mache man es den Kindern ja nicht mit der Musik, findet sie. «Wer schon mit Kindern ein klassisches Konzert besucht hat, weiss, wie schwierig das Stillsitzen für sie ist, und wie gering die Toleranz der andern Konzertbesucher. Kindertheater und Weihnachtsmärchen gab es schon lange, aber Konzerte für Kinder suchte man vergeblich.» Die Konzerte «Extra für Chind» sind eines der ersten Projekte der Stiftung «Kind und Musik», die Erika Hug 1982, zum 175-jährigen Jubiläum des Familienunternehmens, ins Leben ruft. «Es gab keine Stühle im Saal, alle mussten von daheim ein Kissen mitbringen. Nach dem Konzert durften sich die Kinder auf der Bühne die Instrumente zeigen lassen und sie sogar anfassen. Der Erfolg war umwerfend. Die Konzerte fanden im Theater 11 in Zürich-Oerlikon statt, dann auch in andern Schweizer Städten.»
Damit wirft die Stiftung einen Stein ins Wasser, der bis heute Kreise zieht. Inzwischen werden landauf, landab viele Kinderkonzerte angeboten, sogar die Zürcher Tonhalle, diese vornehme, alte Dame, setzt immer wieder welche auf ihr Programm, und das Zürcher Kammerorchester lädt gar zu einem Nuggi-Konzert für die ganz Kleinen ein.
«Pass auf! Nicht anfassen!» Das hört Erika Hug auch im Musikgeschäft. Die Angestellten in der Instrumentenabteilung reagieren nervös auf Kinder, und die Eltern, ängstlich bemüht, teuren Schaden zu vermeiden, versuchen sie unter Kontrolle zu halten. «Wir vermitteln dem Kind: ‹Das ist nichts für dich.› Wie soll es denn eine Beziehung zu einem Musikinstrument aufnehmen können?» Eine weitere Idee nimmt Gestalt an: «Wir brauchen einen Musikladen für Kinder, nach dem Vorbild des Kinderbuchladens gleich hier um die Ecke.» Im Kindermusikladen an der Laternengasse sind die Regale niedrig, alles ist in Reichweite der Kinder, Anfassen erlaubt. «Es gibt auch Kinder-CDS, einfach alles, was ein Kinderherz musikalisch erfreuen kann. Vermutlich ist es weltweit der erste Kindermusikladen, aber längst nicht mehr der einzige. Mir soll es recht sein.»
Der Kindermusikladen bietet auch eine Instrumentenberatung an. Sich die verschiedenen Instrumente von kundiger Hand zeigen zu lassen, sie anzufassen und auszuprobieren – hätte es diese Möglichkeit früher schon gegeben, Erika Hug hätte wahrscheinlich den Weg zum Klavier gefunden, statt sich mit der Geige herumzuquälen.
Sie ist sich bewusst, dass diese Fragen nur in privilegierten Kreisen gestellt werden. «Solange der Musikunterricht freiwillig und kostenpflichtig ist, gehen am Zürichberg die meisten Kinder in die Musikschule, im Schulkreis Limmattal fast keine. Musikunterricht muss einfach zum Lehrplan gehören und gratis sein, für alle Kinder.» Eine Utopie? In der Stadt Zürich gab es das schon einmal. Der umtriebige Zürcher Lehrer und SP-Gemeinderat Rudolf Schoch brachte es fertig, dass 1947 Zürich als erste Stadt in der Schweiz den Blockflötenunterricht in den ordentlichen Stundenplan integrierte und subventionierte. Er legte besonderes Gewicht auf den Gruppenunterricht. Erika Hug erinnert sich gern daran: «Wir hatten eine sehr gute Musiklehrerin, eine Frau Stern, die mich beeindruckte. Wenn alle miteinander Blockflöte spielten, ergab sich ein ganz besonderer Chorklang. Für andere war das vielleicht ein Zwang, aber ich fand es super.»
Das Projekt des «Klassenmusizierens», das von der Stiftung «Kind und Musik» unterstützt wird, geht wesentlich weiter. Die Idee kommt aus den USA, Eckard Harke hat sie in Deutschland kennen gelernt, und Erika Hug hat sie begeistert aufgegriffen. Die Broschüre «Klassenmusizieren» umschreibt sie so: «Man stelle sich vor: Schulkinder, die gemeinsam musizieren. Und zwar alle, nicht nur die durch Elternhaus und kulturellen Hintergrund privilegierten. Man stelle sich Kinder vor, die stolz und sorgfältig mit ihren Instrumenten umgehen, die nach wenigen Wochen satte orchestrale Klänge produzieren und die selbstverständlich Noten lesen können.» In einzelnen Schulklassen und Gemeinden ist das Projekt umgesetzt worden. Mehr Breitenwirkung wäre erwünscht, denn es kommt bei allen Beteiligten sehr gut an, bei Kindern und Eltern wie bei den Lehrpersonen. «Das ist mein Engagement für Kinder. Wenn wir nicht für sie schauen, was soll dann aus unserer Welt werden? Musik ist ein wertvoller Beitrag für die Entwicklung eines Kindes. Das ist meine persönliche Meinung, nicht nur, weil ich ein Musikgeschäft habe.»
Читать дальше