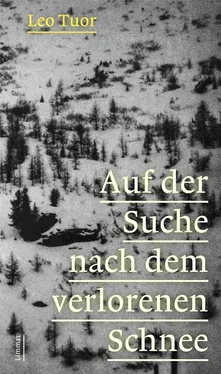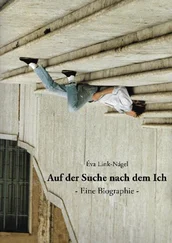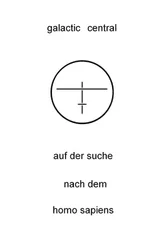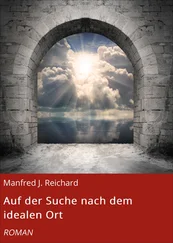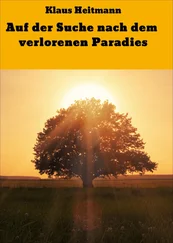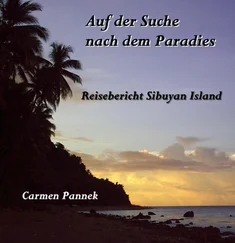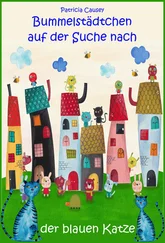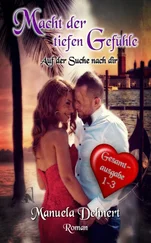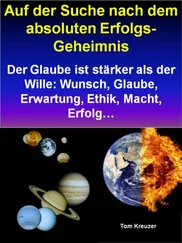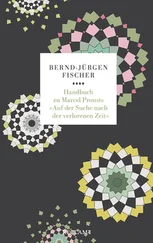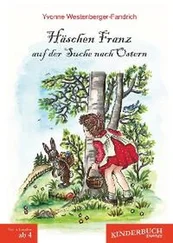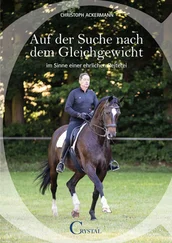Auch wenn die Heimat des Sursilvans nicht die Schweiz ist, wie bewiesen wurde, könnte er nur schwerlich behaupten, dass er selbst nicht ziemlich schweizerisch sei. Sein Tun und Lassen, seine Denkweise sind ganz und gar die eines Schweizers: nichts riskieren, gesichert und versichert sein, nach einer sicheren Stelle lauern. Er ist loyal, konfliktunfähig, autoritätshörig, provinziell, exakt, liebt Geld, ist korrekt, generell langweilig, ehrenwert, pünktlich, pedantisch, ordentlich, mäht am Samstagmorgen den Rasen, ist frisch geduscht, will ja nicht auffallen, ist neutral, perfekt, beobachtet, aber sagt nichts, behält seine Meinung für sich, lässt die anderen Entscheidungen fällen, ist ängstlich, hat keinen Humor, wartet ab, traut nichts, schaut niemandem direkt in die Augen, will seine Ruhe haben, hat einen Zaun ums Haus, ist Cumuluspunktesammler und Regagönner, zieht nach fürobig den Trainer an.
Die Surselver sind weiter Schweizer in dem Sinne, dass sie keine Einheit bilden. Da sind erstens die Walser, zweitens die Romanen, drittens die niedergelassenen Alemannen, welche nicht bereit sind, sich zu integrieren, viertens die Fremdarbeiter. Wäre Graubünden, von der Bevölkerung und von der Perspektive der Kultur mit seinen verschiedenen Sprachen und der verschiedenen Herkunft der Leute her gesehen, so etwas wie eine Minischweiz, dann wäre die Surselva noch einmal ein Minigraubünden. Das ist wie eine Matrioschka mit Kopftuch, jedes Mal ein bisschen kleiner. In der Schweiz haben wir den kalten Frieden zwischen den Sprachen und den Kulturen, man nennt das «kulturelles Nebeneinander», das heisst: Jeder mischt seine Kultur und ignoriert den Nachbarn. Über den Nachbarn wissen wir nichts und meiden ihn. Das ist typisch schweizerisch, typisch bündnerisch, typisch surselvisch. In diesem Sinne ist der Surselver ein typischer Schweizer und der Schweizer ein typischer Surselver.
Die alten Jungfern der Architektur sind die Kapellen. Während die Kaplane verschwunden sind, haben diese sich behauptet. Auf Hügeln und Höhen, aus den Ebenen, von den Hängen herab, an Strassen, hinter Wegkrümmungen, in den Dörfern, auf den Feldern, auf den Alpen, Weiden, allgegenwärtig, geben sie der Landschaft einen Ton. Riechen tun alle gleich: nach Kalk und Weiss die alten, nach Eisenbeton die neuen. Das ist ihr Grundduft, gemischt dann mit dem Duft von leeren Weihwasserkesseln und von fehlendem ewigem Licht, Duft von Altären und Nischen und Schränken und Bildern, Statuen und Spinnen, Gold und Staub, heiligen Tüchern, gefolgt vom bunten Duft von Heiligen mit Mitren, Kronen und komischen Kappen auf dem Kopf, mit krummen Stöcken, Stäben, Schwertern, Zweigen, Kelchen in der Faust, Büchern in der Hand. Die Kapellen riechen nicht nach Menschen. Heilige, männlich und weiblich, um einen Hauptheiligen beherrschen sie. Da hat der Herrgott wenig zu sagen. Alle Kapellen sind Individualistinnen: die runden gemütlichen, die mahnenden, die duckenden, die buckelnden, die kauernden, die ohne Hals, die kauzigen, die spitzen, die hochgewachsenen, die schmalen, die untersetzten, die seriösen, die naiven, die perplexen, die wachen, die mit oder ohne oder einem halbem Turm, der hier selbstbewusst aus dem Dach wächst, dort schüchtern vom Dach späht. Ach, es ist schlimm für eine Talkapelle, keinen Turm zu haben, das macht sie gehemmt und verloren. Auf den Bergen sind Kapellen ohne Hals etwas anderes: graue Schreine mit steilen Dächern in der kargen Landschaft. Es sind Schnecken, die den Kopf so selten herausstecken, dass noch niemand es gesehen hat.
Kapellen sind toleranter als die Kirchen, sind mehr von dieser Welt, wissen noch auf diskrete Art und Weise von der heidnischen Zeit. Edle alte Jungfern mit weggefegten Spinnennetzen oder exotische Wesen, eine jede nach ihrer Art? Beides sind unsere Kapellen. Sieh sie, wie du willst. Sie haben nichts dagegen. Sie sind Meisterinnen darin, sich nicht um die Vergangenheit zu kümmern. So überleben sie, während die anderen kleinen Gebäude: die Bildstöcke, die Wasch- und Backhäuschen, die Heubargen und Heustadel verschwunden sind oder nur noch Geranien auf Fenster und Gesims oder Gebsen und alte Werkzeuge an den Wänden haben.
Die Lawinen muss man nehmen, wann sie kommen. Sie überfallen den Bergler mit Angst, Tod und Zerstörung. Er lebt mit der Lawine, weiss, dass sie immer wieder vom Berg heruntergekommen ist, weiss aber auch, dass sie immer wieder den Berg hinaufgegangen ist im Frühling. Das ist das einfache Wissen des Berglers, welches er gebraucht hat, um auszuharren und zu überleben.
Den Journalisten kommen sie als Sensation. Den Gemeinden bringen sie Arbeit und Subventionen. Unsere Lawinen kann man im einundzwanzigsten Jahrhundert nicht mehr zu negativ sehen, ausser man muss sie am eigenen Leib erfahren. Sie sind Bewegung und Änderung, Eigenwille. Die Zumthor-Kapelle in Sogn Benedetg verdankt ihre Existenz einer Lawine, welche die alte Kapelle zerstört hat. Ganz korrekt wäre: dem Gemeindevorstand, der das Tal mit Bauschutt auffüllen liess, sodass die Lawine gegen die Kapelle hingeführt wurde. Die Lawine also, in Zusammenarbeit mit dem Gemeindevorstand, als Kulturförderin. Der Teufel, der eine Wand der uralten Kapelle zierte, wurde zerstört, später wieder zusammengefügt und treibt jetzt im Pfortengang des Klosters seinen Schabernack. Ein Teufel, nackt wie ein Frosch, der steif auf seinem Thron sass als einer, der weiss, dass jemand ihn fotografieren will, breitbeinig, die Krallenhände auf die Oberschenkel gestemmt, dazwischen ein Bauch mit Augen, zwischen den Beinen das schwarze Loch eines kleinen offenen Mundes und hinunter bis zum Boden ein schrecklich langer Schwanz, ein Rüssel, der den Leib eines nackten Sünders umklammert. Dies scheint der Gehörnte ganz lustlos und ohne Gier zu tun, schaut uns wie ein Esel mit dem unschuldigen Gesicht eines Kindes an. Seine lächerlichen Schafsohren stehen gerade ab, aber leicht hängend, was zeigt, dass er ein Gewissen hat. Du, Teufel von Sogn Benedetg, wie viele Generationen haben mit Schrecken auf deinen Unterleib, dann in dein Gesicht geschaut und gesehen, dass es ganz so unerbittlich doch nicht sein kann.
Den Charakter dieser Landschaft geben nicht die Wasser, nicht die Täler, nicht die Gletscher, den Charakter dieser Landschaft gibt schlussendlich der Mensch. Ich fantasiere die Täler, eingefressen in seinen Schädel, mit Hilfe des Hirns, das frei formt, was es will: vielleicht die Berge, die Kapellen, die Lawinen, die Ferienprospekte, möglicherweise triste Teufel oder brüllende Hirschstiere mit gegen den Himmel gereckten Hälsen oder, wenn es meint, adornische Murmeltiere, die mit Dampf pfeifen. Aber immer ist er, der Schädel, das Zentrum, sieht, was er will, formt seine private Surselva.
Aus dem Rätoromanischen von Christina Tuor-Kurth
Die Wäscherin und die Mulde
Dem Hüter der Worte, Alexi Decurtins
Kürzlich habe ich ein Buch aus einer Mulde genommen, jemand hatte geräumt. Auf dem inneren Buchdeckel stand mit Schreibfeder geschrieben: «Dieses Buch gehört mir, Martin Schvarz von Madernal 1843.» Oh, du armes Buch, habe ich gesagt, dein Besitzer ist schon lange tot, komm mit mir, die Mulde ist nichts für dich.
Die Titelei fehlte – zu meinem Glück und dem Unglück dessen, der das Buch weggeworfen hatte. Ab Seite neunzehn folgen Kolonnen und Kolonnen Wörter, jeweils vier Reihen nebeneinander: Deutsch, Italienisch, Sursilvan, Puter, manchmal auch Vallader. Exakt einhundert Seiten. Die Listen richten sich nicht an eine Leserschaft eines bestimmten Idioms, sondern an alle Bündner. Gott behüte, rasch habe ich, Büchernarr der ich bin, gesehen, dass es sich um den «Otto Carisch» von 1836 handelt, eine unserer ersten Wörtersammlungen, eine Art Wörterbuch. In diesem sind die Wörter nicht, wie wir es uns gewohnt sind, alphabetisch geordnet, sondern nach der Bibel. Es beginnt mit Gott – Dio – Deus – Dieu, dann folgt all das, was Gott erschaffen hat: die Welt – il mondo – il mund – il muond // der Himmel – il cielo – il tschiel – il cel, darauf folgt die Sonne, dann Stern, Luft und Wind. Als zweites Thema kommt, wie könnte es besser zu uns passen, all das, was mit verwandtschaft zu tun hat: der Vater – il padre –
Читать дальше