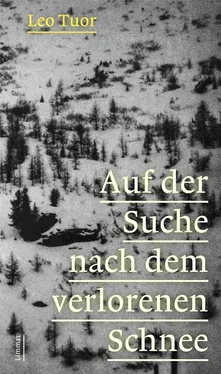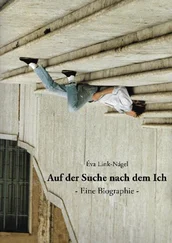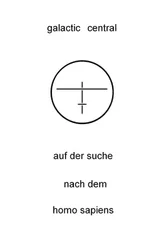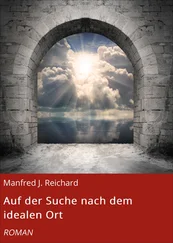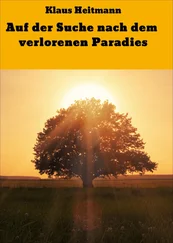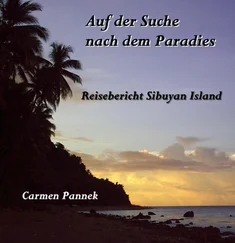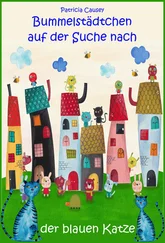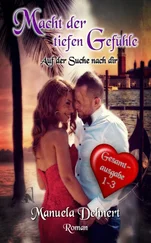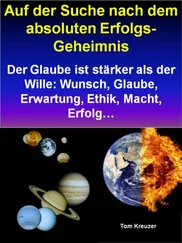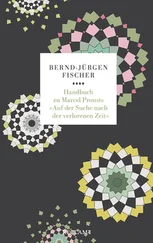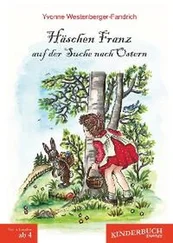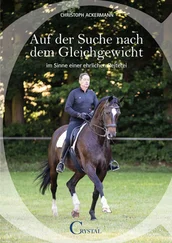Die hohen Berge haben die Fremden verherrlicht, und wegen ihnen haben wir gemerkt, dass sie um uns sind. Sie sind für uns nicht majestätische Kathedralen, ewige, reine. Zwar vielleicht schon ewiger als der ewige Schnee, aber die Berge sind Berge, nicht Freiheitssymbole, nicht intakt, nicht virginal, keine Kontraste zur Zivilisation. Wir wissen noch heute kaum ihre Namen. Das interessiert uns nicht. Weil die höchsten überhaupt nicht vom Rheintal aus zu sehen sind, sind sie irgendwie virtuell. Vom Tödi reden alle respektvoll, fast leise, wie wenn sie über den Everest reden würden, er ist schliesslich auch unser Everest. Und von beiden Bergen wissen wir gleichviel, nämlich nichts. Fazit: Tödi und Oberalpstock sind zwar respektable Grössen, aber unbekannte, darum brauchen wir auch fast exklusiv ihre deutschen Namen statt der romanischen Russein und Tgietschen.
Der Berg ist für uns also anonym. Von der Masse der Berge um uns kennen wir weder Silhouette noch Name. Sie verstehen sich für uns von selbst, ohne Etikette. Sie gehören zu uns. Wir sind die Berge. Landschaften ohne Berge wären für uns keine richtigen Landschaften. Sind das überhaupt Landschaften? Gibt es überhaupt solche? «Gibt’s Länder, Vater, wo nicht Berge sind?» Das ist die Frage, die den Bergler am besten charakterisiert. Hier hat es Schiller auf den Punkt gebracht. So fühlen wir. Aber wenn er, vom Nebel des deutschen Idealismus umhüllt, «Auf den Bergen ist Freiheit!» posaunt, dann ist das ein Flachländer, der etwas behauptet; dann verwandelt er sich in einen Touristen oder im schlimmsten Fall in einen Werbeagenten, der seine Platte aufgelegt hat. In den Bergen, meinen jene, sei die Freiheit in dem Sinne zu verstehen, dass sie tun können, was sie wollen: zelten, ihre Hunde frei und ungehindert herumspringen lassen, hinter jedem Stein die Hosen runterlassen etc. Für uns sind die Berge Tyrannen, die Perspektive, Geist und alles eingrenzen und einengen. Jahrhunderte haben sie uns im Winter – das ist das halbe Jahr – von der Aussenwelt abgeschnitten, isoliert. Immer haben sie mit Lawinen gedroht. Eingeschlossen zu sein, war normal. Heute sind wir daran nicht mehr gewöhnt. Die Strassen haben offen zu sein, damit die Fremden abhauen können, wenn es darauf ankommt. Lawinen, ja cool, aber bitteschön nicht, wenn wir Ferien machen.
Neben den grossen Bergen mit ihrer Aura des Unerreichbaren ist eine andere Sorte Berge zu nennen, eine Art volkstümlicher Berge. Wenn man von unten heraufkommt und durch Flims hindurch im Stau steht und vor den Deutschen Acht gibt, die auf die Klötze treten und mit dem Blinker weder ein noch aus wissen, ist da einmal der Flimserstein mit seiner titanischen Wand über dem Dorf; würdige Wand, um daran einen himmelstürmenden Prometheus zu schmieden, ein horizontaler Berg ohne Spitze, der oben eine Ebene ist, eine Alp. Er ist immer noch ein Handlungsort für verschiedene Märchen und Sagen, wo Berge stürzen, Blitze blitzen, Kühe verschwinden, wo Hexen ihre Rituale machen, wo uralte Eulen landen und ihre kauzigen Kommentare geben. 2Dann, schaut man geradeaus, erblickt man den Crap Sogn Gion und den Crap Masegn, jetzt magische Kulthügel für Snöber und Carver. Diese bedauernswerten Berge müssen im Winter täglich Tausende von bunten Leuten ertragen, die über sie hinwegflitzen. Wäre es nach den Touristikern gegangen, hätte man sie in Crap I und Crap II umbenennen sollen, scheinen doch diese Bergkuppen mit ihren zungenbrecherischen Namen gegen die hektische Invasion zu protestieren. Wenn die Show der Meute vorbei ist, wenn die Sonne untergegangen ist, beginnen die Pistenmaschinen den Berg hinaufzuschaben. Und jetzt, wenn unser Auto diese «Topregion des Tourismus» hinter sich lässt und gegen Ilanz fährt, sehen wir bald vor uns den vierten volkstümlichen Berg, den Péz Mundaun, den Eckpunkt zwischen dem Rheintal und der Val Lumnezia, von den Lehrern seines Panoramas wegen als Bündner Rigi bezeichnet, jedem surselvischen Schüler der obligatorischen Schulreise wegen, die er mit kurzen Hosen einmal nach dorthin gemacht hat, bekannt.
Eine ganz spezielle Sorte von Bergen sind die heiligen Berge. Heiliger Berg meint hier nicht das Numinose, welches jedem Berg anhaftet, meint auch nicht Berge mit aufgepflanztem Kreuz, womöglich mit romanischen oder lateinischen Sprüchen daran, z.B. E montibus salus – diese Kreuze der Kreuzfahrer mit ihrer Wahnidee, erobern zu müssen. Die heiligen Berge sind im besten Fall mit Antennen und Schirmen bespickt, nationale Berge, je näher dem Gotthard desto hohler.
«Gibt es hier auch Wild?» Standardfrage des Touristen. «Ja es gibt hier auch Wild», sagt der Jäger, «aber lesen Sie lieber Adorno. Sie sehen aus wie einer, der Adorno liest!» Jäger zitiert feierlich Adorno mit romanischem Akzent: «Wer einmal den Laut von Murmeltieren hörte, wird ihn nicht leicht vergessen. Dass er ein Pfeifen sei, sagt zu wenig: es klingt mechanisch, wie mit Dampf betrieben. Und eben darum zum Erschrecken. Die Angst, welche die kleinen Tiere seit unvordenklichen Zeiten müssen empfunden haben, ist ihnen in der Kehle zum Warnsignal erstarrt; was ihr Leben beschützen soll, hat den Ausdruck des Lebendigen verloren. In Panik vorm Tod haben sie Mimikry an den Tod geübt.»
Tourist ist von diesen Beobachtungen Adornos begeistert. Jäger denkt für einen Moment daran, Touristen eventuell mitzunehmen, um das echte Murmeltier zu zeigen, die Gemse, den Steinadler. Steinadler ist für Touristen die Krone der Tiere der Alpen. Er würde verwundert fragen: «Steinadler hat es?» Aber die Frage wird gar nicht gefragt. Der Respekt vor dem Murmeltier des Philosophen lässt den Fremden selbst den sonst so begehrten Steinadler vergessen.
Die Murmeltierwachen stehen wie Hydranten oder Buben mit langen Pelerinen oben in den Geröllhängen. Drehen einzig manchmal mechanisch den Kopf um fünfzehn, um dreissig, um fünfundvierzig Grad, während der Körper ganz still Männchen macht.
Die Surselver sind stolz auf die Surselva, das ist ihre Heimat, nicht die Schweiz. Nicht einmal im Ausland würden viele Surselver, wenn sie gefragt würden, sagen, dass die Schweiz ihre Heimat sei. Einzig, wenn sie in einem Chor sind, singen sie das mit klaren Stimmen, sie sind also nur im Männerchor Schweizer Patrioten. Dies, weil sie, was sie singen, nicht verstehen wollen und weil sie, sich der Autorität des Dirigenten unterwerfend, nicht wagen zu sagen: «Diesen Text singen wir nicht.» Die Texte der Lieder machen mit unseren Sängern, was sie wollen. Die absolute Autorität des gereimten Wortes. Für die Surselver, wenn sie nicht singen, hat die Schweiz etwas mit Eidgenossen, Lanzen und Hellebarden zu tun, mit Bern, mit Sempach, mit Zürich, aber nicht mit der Surselva. Für die romanischen Surselver ist Surselva noch mehr Heimat, wegen ihrer Sprache, die nach der Landschaft das Sursilvan genannt wird. Heimat hat also auch etwas mit Sprache zu tun – nein enger –, mit Dialekt. Die Engadiner sprechen ja auch Romanisch, aber nicht unser Romanisch. Darum ist das Engadin nicht die Heimat der Sursilvans. Im Engadin fühlt sich der Sursilvan als Deutscher. Er wird deutsch angesprochen, hat Preise wie die Touristen zu bezahlen, müsste von allem begeistert sein. In Laax auf der Piste sind die Einheimischen, die im Umkreis von zwanzig Autominuten wohnen, Touristen, man redet deutsch mit ihnen, sie haben Preise wie die Fremden zu bezahlen, sollten von der Landschaft begeistert sein, welche ein Zirkus zu sein hat, «Weisse Arena», alpiner Kampfplatz des surselvischen Amphitheaters. Die Imperatoren des weissen Schnees haben die Berge geglättet, den Gletscher behandelt, Steine liquidiert, Wald umgeworfen, Erde aufgewühlt, Kanonen aufgerichtet, Natur beleuchtet. Das wollen die Gäste so und wer zahlt, befiehlt: die Alemannen, die Deutschen, die Italiener, die Holländer, die einheimischen Touristen. Unsere Landschaft ist Produkt geworden. Wie ist es merkwürdig, Tourist in der Heimat zu sein. Arena ist nicht Heimat. Heimat ist dort, wo du nicht Tourist bist, dort, wo du keine Souvenirs kaufst, wo du nicht ständig den Fotoapparat dabei hast, wo du die Museen nicht kennst. Vielleicht dort, wo du dich zu Tode schuftest. Nein, dort ist es schon nicht mehr Heimat. Das wissen die Sursilvans in der Fremde am besten. Dieser Typ von Sursilvan ist aus ökonomischen Gründen in die Schweiz ausgewandert, wegen besserer Lohnperspektiven, der Karriere wegen. Er macht Ferien in der Heimat, besitzt dort ein Maiensäss, eine Wohnung, kommt im Sommer, um Servelas zu grillieren, und im Winter, um Ski zu fahren. Er ist einheimischer Tourist, eine Art sanfter Tourist. Er erzählt ständig, wie es früher hier war. Heimat ist das, was du meinst gehabt zu haben, «was die Zeit unter ihrem Schutt zudeckt; was wir verlieren, ohne vergessen zu können», sagt Iso Camartin. Dann hätte Heimat auch etwas mit Erinnerungen zu tun. Surselvische Heimat ist dort, wo ich das Bild der Dörfer, die Lawinenzüge, das Abschüssige der Hänge, die Bahnen der Pisten, die Neugier der Steinböcke, die Umrisse der Berge kenne oder zu kennen meine, wo ich weiss, an welchen Ecken Geschwindigkeitskontrollen gemacht werden, wo es richtige capuns zu essen gibt. Die Tarotkarten sind Heimat, die Musikgesellschaft, die Jungmannschaft, der Skiclub, das Jagdgesetz.
Читать дальше