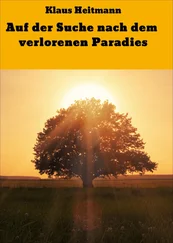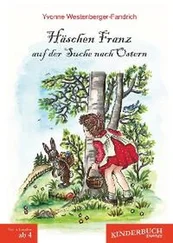Die Generation unserer Grossväter hat den Rhein in ein mehr oder weniger definitives Bett gezwungen. Vorher floss er hierhin und dorthin, überflutete Felder und Weiden, liess Steine zurück, Holz, Dreck, Sand. Die Generation unserer Väter hat dem Rhein die Wasser genommen, oder besser gesagt: sie nehmen lassen, für ein, zwei Goldvreneli und schlechte Verträge. (Die Zürcher zahlen für unseren elektrischen Strom weniger als wir. Wir subventionieren Zürich auf unsere Art.) So ist der Rhein heute bezwungen, ein Sklave. Riesige Staumauern, die den Bauch vor dem Betrachter nach innen pressen, spannen die Wasser zusammen, lassen sie nicht in ihr natürliches Bett fliessen. Die Wasser werden geleitet, gepumpt, durch künstliche, fast offizielle Wege gepeitscht: kilometerlange Tunnels sind in die Felsen gesprengt. Oh, wie der Berg beleidigt ist. Ah, wie die Wasser nur mit Widerwillen durch diese dunkelsten Felsröhren gehen, mürrisch, nervös. Sonst so lustig, hier gefangen, brausen sie wütend in die Seen, schäumen. Die künstlichen Seen Curnera, Nalps, Lukmanier, Zervreila fassen die Wasser von Tujetsch, fassen die Wasser von Medel, fassen die Wasser des Adula. Sie geben der Landschaft einen neuen Charakter. Wir waren an die Seen von Laax und Flims, an die Hunderte von alpinen Seelein gewöhnt: Tomasee, Lag Serein, Lag da Laus und wie sie alle genannt werden ihrem Aussehen entsprechend. Unsere neuen Seen, die unsere Väter mit den Italienern, welche sie geholt hatten, bauten, sind das Symbol der Kultur des Betons, Hunderttausender von Kubikmetern Beton. Es ist die Zeit der Geburt von Kies- und Sandwerken am Rhein, grauen Gebäuden, immer in Staub und Lärm gehüllt. Um sie herum Berge von Steinen, von Sand, von Steinchen in allen Grössen, und überall die riesigen Maschinen, die wühlen, schwarzen Rauch auspusten, nach Öl riechen. Es ist die Zeit des Fettes und des Diesels, der grauen, blauen Überkleider, der Kompressoren, der Steinbrecher, der Förderbänder, der Krane, die sich einer neben dem andern am Himmel drehen. Die Zeit, in der man erfunden hat, wie man aus Steinen Gold macht. Die Werke sind Geldgruben geworden. Die Zeit der Lastwagen mit den grossen Lenkrädern und den warmen, nach vorne gereckten Nasen.
Das ist das Goldene Zeitalter oder das Zeitalter des Betons, das lange, lange nach der Steinzeit und der Bronzezeit folgte. Statt der Saurier husteten die Saurer die Pässe hinauf, die Chauffeure mit hochgekrempelten Ärmeln. Sie fuhren der Hochkonjunktur entgegen.
Die Konjunktur beginnt also mit den Italienern, die man heute nicht mehr will, mit dem Beton, mit dem Diesel. Pompös stehen die Mauern hier, beeindruckende Riesen, die ein Tal beenden, wenn wir vor ihnen stehen. Sie zwingen uns, hochzuschauen, wenn wir vor ihnen stehen. (Ich stelle mir ein verbrecherisches Saxofon vor, ein Seepferdchen, aber riesig wie ein Rindvieh, das seine Schreie mit Beharrlichkeit schmettert. Die Hornstösse durchdringen Knochen und vibrierten Beton. Stelle mir vor, dass Jericho sei.)
Auf der Schulkarte des Kantons Graubünden haben diese Mauern eine gewisse Aggressivität: Als brauner Strich mit Zähnen nach vorne sind sie gezeichnet. In der romanischen Zeichenerklärung werden sie als Mir da levada bezeichnet. (Mit levada assoziiert der Romane «Auferstehung».) Warum levada? Weil die Mauern die halb tote Konjunktur in blühendes Leben erweckt haben?
Nicht alle Seen sind gebaut worden, wie sie wollten, die Bosse mit den Zigarren, mit den Mappen, die Herren von Baden. Unsere Schulkarte zeigte einen grossen blauen Fleck mit der Form einer Niere zwischen Pass Diesrut und Passo della Greina. Dieser See wurde nur gezeichnet, nie gebaut. – «Wohin wäre die Staumauer gekommen?», fragt der Fremde den Hirten. «Wo wär do d’Staumur cho?», grüsst der Schweizer den Hirten. Der Einheimische fragt nichts, ihm wäre die Mauer willkommen gewesen, egal an welchem Ort, Hauptsache die Gelder wären gekommen. Kurios, der Sursilvan der Generation meines Vaters ist sonst nicht derjenige, der Seen liebt, er fürchtet das Wasser, latscht nicht mit Schnorchel und Flosse, zeigt nicht gerne die weisse Haut, das Nabelloch mit womöglich einer Fussel drin. Aber in der Ebene der Greina, sagen sie, wäre ein See schön gewesen. Schön ist für den Philosophen, wie wir wissen, «was ohne Interesse wohlgefällt». Aber die Generation meines Vaters war ja interessiert, also musste «schön» für unsere Väter etwas mit dem Gebrauchswert einer Landschaft zu tun haben. Die Niere ist jedenfalls auf dem Papier geblieben, und in den Schädeln. Die Greina hat trotzdem ihren See bekommen. Unterhalb des Terri, dort, wo der Wanderer Gletscher erwartet, wenn er von Canal hinaufsteigt, steht er verblüfft vor einem Riesensee. Dumpf schlagen die Wellen gegen den Fels, Eis schwimmt in grauem Wasser. Der Gletscher ist ein sterbendes Tier. Das Weiss, das Blau des Berges weicht dem Wasser, dem Grau und bald schon dem Grün.
Die Gletscher sind oben in dieser Landschaft, auf den höchsten Bergen, unter den spitzen Gipfeln. Schon lange machen sie den braun gebrannten Führern mit ihren schwarzen Sonnenbrillen, Handys, Seilen und Pickeln keine Angst mehr. Ihre Pickel sind kürzer geworden und ihr Respekt vor dem Berg kleiner. Nur dem gemeinen Volk machen die Gletscher mit ihren offenen Spalten oder versteckten Klüften noch Angst. Die Zungen haben sie schon lange eingezogen. Der Tourist tut gut daran, sie von allen Seiten zu fotografieren: Glatscher da Medel, clic, clic, clic; Glatscher dalla Greina, clic; Glatscher da Gaglianera, existiert nicht mehr; Glatscher da Gliems, clic; Glatscher da Punteglias clicclic; Glatscher da Rialpe, nicht mehr; Glatscher da Frisal, clic; Glatscher dil Vorab, clic, clicadiclic. Die Zukunft zeigt die Gletscher nur noch auf den Abzügen der Touris, auf den Panoramen der Pioniere. Und ihre Seelen, wo sind ihre Seelen, wenn die Gletscher geschmolzen sind? Die Gletscher, die Tiere mit den grössten Seelen.
Und die Sonne lacht. Nicht die wahre Sonne, die auf Prospekte und Logos gedruckte Comic-Sonne, diese mit ein paar gelben Strichen gezeichnete Sonne, die das Blaue vom Himmel herunterverspricht. Himmel der Surselva, immer blau, während der Himmel der anderen Landsleute, die wir instinktiv nicht allzu sehr lieben («Wer mit den Fremden ein Geschäft machen will, darf sie auch nicht besonders mögen.» Dürrenmatt), im Unterland in Nebel eingehüllt ist. Übrigens bestätigt auch das «Ferien- und Freizeitbuch Disentis-Sedrun Cadi»: «Nebel ist hier praktisch nie zu erdulden.»
Wie ist unser aktueller Himmel noch? Kreuz und quer eingeritzt von Flugzeugen, die mit der family in die Bahamas fliegen, weil die anderen das auch tun.
Wie wünschen wir uns unseren aktuellen Himmel noch? Manchmal grau-weiss voller Schneeflöckchen, die leicht mit dem Wind tänzeln. Lieber aber voller schwerer Schneeflocken, die ohne Unterlass fallen und Pisten und Dächer bedecken. Manchmal aber, wenn wir aufstehen mögen, ein rot vergoldeter Himmel, silbern und weiss ich noch was, wenn die Sonne aufgeht: feuriger Himmel zwar, aber nicht ohne etwas Diskretes, das daraus einen Akt macht. Einen religiösen Akt, pompös, meditativ, oder nach dem Geschmack eines jeden Bauches, wie er sich das zu fühlen vorstellt. Und was ist über dem Himmel der Surselva, über den Flocken, über den Wolken, über den Flugzeugen, über dem Blau, über der Morgenröte? Dort ist immer noch dieser Himmel, der früher voll von Heiligen war, Herrgöttern und Müttergottes, Avemarias und Vaterunser, mit goldenen Strahlen und glänzenden Heiligenscheinen, dort ist jetzt immer noch dieser himmlische Himmel, aber – leer.
Von den Rheinen zu den Himmeln, eine waghalsige Reise. Ständig wird der durch die Surselva Reisende mit einem Rhein oder mit einem dieser Himmel konfrontiert. Auf den Brücken extremerweise mit beiden zusammen. Der Himmel ist wegen der Tiefe zu Füssen anders von einer Brücke aus. Aber um das wahrzunehmen, ist es erforderlich, zu Fuss über die Brücke zu gehen. Der Rhein ist wegen der Tiefe anders von einer Brücke aus, schmäler, weisser und sein Rauschen ist irgendwie reiner, lädt vielleicht zum grossen Sprung ein; Lore, Lore, Loreley.
Читать дальше