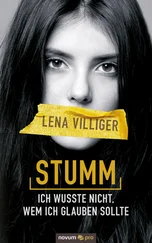Die exakte Zahl der benötigten Marmeladeschälchen, Butterschälchen und Brotkörbchen wurde anhand eines Tagesplans ermittelt, der in einer Schublade neben der Küchentür aufbewahrt wurde und den ich anfangs nicht zu sehen bekam. Er wurde von der Schwester an der Pforte erstellt und enthielt neben Angaben darüber, wer aktuell im Haus war, wer an diesem Tag abfuhr oder ankam, welcher Pater wo die Messe feierte und welche besonderen Vorkommnisse es gab, auch den Hinweis, wie viele Personen welche Mahlzeiten in welchen Räumen einnahmen. In der Regel waren das circa 25 Schwestern, die im Refektorium aßen, circa zehn Patres, die im Pilgerheim aßen, und diverse kleinere Tische an der Pforte. Denn ein Frühstück zu zweit, dritt oder viert wurden gerne für persönliche Gespräche unter Verantwortlichen oder mit Gästen genutzt. Mutter Marozia schien überhaupt nur in den Empfangszimmern an der Pforte zu essen. Selbst wenn sie allein war. Das alles merkte ich allerdings erst viel später, als ich diesen Tagesplan selbst zu Gesicht bekam.
Dass das alltägliche Zusammenmixen von Marmelade- und Butterresten hygienisch bedenklich sein könnte, kam mir nicht in den Sinn. Genauso wenig war mir bewusst, dass keine der in der Küche arbeitenden Schwestern für diese Tätigkeit auch ausgebildet war. Erst Stück für Stück erfuhr ich, dass sie mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen worden waren und schlicht ihr Bestes versuchten. Sr. Ivana beispielsweise sagte, dass sie vor ihrem Eintritt gar nicht kochen konnte. Sie hatte studiert und wollte Lehrerin werden. Nun leitete sie die Mutterhaus-Küche und kochte täglich für dreißig bis fünfzig Personen. Sie schien wie andere, denen es ähnlich ging, stolz darauf zu sein. Denn in der Königsfamilie war es ein Zeichen besonderen Gottvertrauens, wenn man eine Aufgabe erfüllte, ohne die nach menschlichem Ermessen dafür nötigen Voraussetzungen zu erfüllen. Wer etwas tat, was er gelernt hatte, tat ja schließlich nichts Besonderes. Er war sogar in Gefahr, sich etwas auf sein Können einzubilden. Wer aber eine Aufgabe annahm, der er sich nicht gewachsen fühlte, musste sein Vertrauen ganz auf Gott setzen. Die Oberen konnten ein Mitglied also gewissermaßen alleine dadurch, dass sie ihm einen Auftrag gaben, auch schon zur Erfüllung dieses Auftrags befähigen, denn wenn sie etwas verlangten, würde Gott zweifellos die dafür nötige Gnade schenken. Egal ob das Mitglied für diese Aufgabe geeignet war oder nicht. Einen Auftrag auszuführen, ohne das nötige Wissen und Können dafür zu besitzen, war eine von allen geforderte Tugend. Man nannte das einen »Glaubensakt«. Diese Glaubensakte waren das Thema zahlreicher Predigten und Vertiefungen.
Zwei bemerkenswerte Begebenheiten
Dass das alles problematisch war, merkte ich anfangs noch nicht. Im Haus begegnete ich keinen überforderten, sondern nur fröhlichen und zufriedenen Menschen. Und ich glaubte vollkommen an diese Fröhlichkeit, meine eigene wie die der anderen. Dieser erste Sommer war sicher meine glücklichste Zeit in der Königsfamilie. Zwei Dinge aus dieser Zeit sind noch bemerkenswert, denn sie ragen aus dem Klosteralltag heraus und sind mir im Gedächtnis geblieben.
Zum einen war da ein auf den ersten Blick sehr gewöhnlicher Verwaltungsakt. Ich musste natürlich amtlich gemeldet werden. Merkwürdig war nur, dass Sr. Reta, eine kleine, etwas rundliche Belgierin mit angegrauten dunklen Haaren, mich aufs Amt begleitete. Mehr noch, sie übernahm alles für mich. De facto begleitete ich sie, während sie mich meldete. Ich musste bei der ganzen Prozedur nicht einmal den Mund auftun. Ehrlich gesagt, dachte ich mir damals nichts dabei. In der Königsfamilie schien es ganz normal zu sein, dass man nicht alleine aufs Amt ging. Man wurde wie ein Kind behandelt, und indem man so behandelt wurde, machte man sich diese Rolle zu eigen, ohne dessen gewahr zu werden. Erst einige Wochen später spürte ich, wie unselbstständig ich in kurzer Zeit geworden war. Im Vorbeigehen im Kreuzgang sagte Sr. Luisa mir, ich bräuchte einen Reisepass (ich hatte nämlich noch keinen). Instinktiv wartete ich darauf, dass sie mir sagte, wer mich wann wohin begleiten würde, um einen zu besorgen. Als Sr. Luisa das merkte, reagierte sie ungehalten und sagte: »Ach Kindchen, schnapp dir doch ein Rad und fahr zur Botschaft. So schwer kann das doch nicht sein!«
Tatsächlich wusste ich weder, dass es im Mutterhaus Fahrräder gab, die ich benutzen konnte, noch dass man als Deutsche im Ausland einen Reisepass bei der Botschaft beantragt, geschweige denn, wo die Botschaft war. Ich hatte ja noch nie im Ausland gelebt und kannte mich in der Stadt nicht aus. Mein Leben spielte sich fast komplett hinter den Klostermauern ab. Woher hätte ich wissen sollen, wo die Botschaft war? Sr. Luisa beschrieb mir den Weg dorthin, gab mir das Geld für die Verwaltungsgebühr mit, und somit war ich nach Wochen wieder das erste Mal alleine auf der Straße. Ich ging zu Fuß, wie ein geschlagenes Kind, in dem merkwürdigen Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben und nicht zu wissen, was.
Erst viel später dachte ich über dieses Erlebnis nach. Sowohl Sr. Reta als auch Sr. Luisa hatten ganz selbstverständlich ein bestimmtes Verhalten von mir erwartet. Einerseits sollte ich gefügig sein, andere für mich sprechen lassen und nur tun, was mir gesagt wurde. Andererseits sollte ich doch wieder selbstständig sein, ohne aber die nötigen Mittel dafür zu haben. Und es gab keine Möglichkeit für mich herauszufinden, wann ich was sein sollte. Ein Zwiespalt, der sich durch mein ganzes Leben in der Königsfamilie zog. Zweifellos hat die erste Haltung bei weitem den Vorrang in der Ideologie und Praxis der Königsfamilie. Mit der Zeit kam ich zu dem Schluss, dass Selbstständigkeit tatsächlich nur dann von einem Mitglied verlangt wurde, wenn sich niemand sonst mit der betreffenden Person oder dem jeweiligen Vorhaben herumschlagen wollte.
Die andere bemerkenswerte Begebenheit betraf nur mich allein. Ohne mir recht bewusst zu sein, warum, notierte ich eines Tages in der Küche eine Frage auf einen Zettel, den ich mir dann in die Schürzentasche schob: »Was ist der Sinn von Jungfräulichkeit?« Ich kann heute nicht mehr sagen, was genau der Grund dieser Frage war. Ich erinnere mich aber, dass ich damals – anders als in der darauffolgenden Zeit – noch die lebhafte Angewohnheit hatte, über alles Mögliche nachzudenken, mir Fragen zu stellen und Antworten zu suchen. Die Frage bereitete mir wirklich Kopfzerbrechen, und ich erinnere mich deutlich, wie erschrocken ich darüber war, weil ich mir nie zuvor ernsthafte Gedanken darüber gemacht hatte. Ich hatte einfach akzeptiert, was gesagt wird: Wer nicht verheiratet ist, der hat das Herz freier für Gott. Nun leuchtete mir das mit einem Mal nicht mehr ein. Was hatte biologische Jungfräulichkeit mit einer besonderen Liebe zu Gott zu tun? Ich war aufgewühlt, aber ich konnte mit niemandem darüber sprechen. Schließlich sagte ich mir, dass Jungfräulichkeit erstens einfach Teil meiner Berufung war, dass zweitens meine zukünftige Verantwortliche mir zufriedenstellende Antworten geben würde und ich drittens eine weitere Gelegenheit hatte, mich in Geduld zu üben und dadurch mein Gottvertrauen unter Beweis zu stellen. Damit war ich vorerst zufrieden.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.