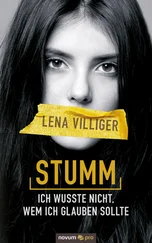Liebte ich ihn? Eher nicht, aber ich mochte ihn irgendwie. Konnte es nicht sein, dass Gott mir jetzt ein Zeichen gab, dass ich für diesen Menschen da sein sollte? Aber wie? Ich war komplett durcheinander und schrieb Sr. Ottilie einen Brief. Sie war höchst alarmiert und reagierte umgehend. Am Telefon kündigte sie an, dass sie mit mir eine Pilgerfahrt nach Altötting unternehmen würde. Die Muttergottes würde mir Klarheit schenken. Ich merkte ihrer Stimme an, dass sie sich große Mühe gab, möglichst ruhig zu bleiben. Da war nichts von der üblichen helltönenden Selbstsicherheit. Zwar erschien mir ihre aufgeregte Sofortmaßnahme allzu panisch, aber ich war doch irgendwie dankbar, dass mich in dieser schwierigen Situation jemand an die Hand nahm, und ich war insofern beruhigt, als sie die Entscheidung nicht selbst fällen wollte, sondern sie der Muttergottes überließ.
Es war ein Samstag im Mai, als wir mit dem Auto nach Altötting fuhren. Sr. Ottilie schien sehr besorgt und versicherte mir, dass sie sehr viel für mich gebetet habe. Besonders beim Breviergebet habe sie an mich gedacht, nämlich beim Psalmvers »Gib dem Raubtier das Leben deiner Taube nicht preis.« Hätte ich Sr. Ottilie nicht gekannt, wäre mir diese allzu drastische Metapher unangenehm gewesen. In ihren Augen war mein Religions-Lehrer, den sie nie getroffen hatte, ein Raubtier, ein böser Verführer, ein Werkzeug Satans, jemand, der mich vom Plan Gottes abbringen wollte. Der gefürchtete Berufungskampf war ausgebrochen, also musste sie nun um mich kämpfen. Wie sie da mit hoch erhobenem Kopf und entschlossenem Gesichtsausdruck am Steuer saß, sah ich sie gleichsam eine Rüstung tragen. Die Kriegerin auf dem Weg in die Schlacht. Ich musste schmunzeln. Ich selbst hielt mich keineswegs für verführt, ich war nur durcheinander.
Im bayerischsten aller bayerischen Wallfahrtsorte war ich noch nie gewesen. Er wirkte unspektakulär, denn viel war dort nicht los. Sr. Ottilie schien auch kein Programm geplant zu haben. Wir gingen einfach von einer Kirche oder Kapelle in die nächste. Dabei entdeckte sie überall Zeichen, die – wie sie sagte – eine ganz eindeutige Sprache sprachen. Viele dieser angeblichen Zeichen verstand ich nicht. Es war nichts Verwunderliches, an diesem Ort auf Marienbilder zu stoßen, Sr. Ottilie aber erkannte in den Bildern einen Hinweis auf meine Berufung zum geweihten Leben. Gekrönt wurde diese Fülle an Zeichen, als wir eine Kirche betraten, in der gerade das Evangelium verlesen wurde: »Wer um meinetwillen Haus oder Brüder … verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen.«
Sr. Ottilie schien so erschüttert und beglückt, dass ich in mich hineinschmunzeln musste. In ihren Augen war das ein eindeutiges Zeichen. Ich hatte gar nicht zugehört und hätte das Evangelium auch nicht als Zeichen gedeutet. Es antwortete nicht wirklich auf meine Frage, aber für sie schien die Angelegenheit geklärt. »Die Muttergottes hat gesprochen!«, verkündete sie feierlich, als wir die Kirche verließen. Ich war zufrieden, denn ich hatte in den vergangenen Stunden genug Zeit gehabt, um meine Frage selbst zu überdenken und im Gebet vor Gott zu bringen. Nein, es konnte nicht gut gehen, wenn ich meinen Religions-Lehrer heiratete (und eine uneheliche Beziehung kam nicht infrage). Er war so viel älter als ich, und wir waren viel zu unterschiedlich. Ich würde ihn aus Mitleid heiraten. Es wäre nicht richtig. Nein, ich war nicht bei ihm, sondern bei den Schwestern daheim, in der Welt des Stundengebets und der regelmäßigen Abläufe, der diskreten Freundlichkeit und der stillen Arbeit. Letztlich glaubte ich vor allem eines nicht: Dass er mich liebte. Er suchte etwas in mir, aber nicht mich. In unerschütterlicher und zugleich tröstlicher Klarheit stand für mich fest, dass mich eigentlich niemand suchte und kannte – niemand außer Gott. Also konnte mich auch niemand außer Gott lieben.
Mit dem Ende der Schulzeit hatte für mich ein neuer Abschnitt begonnen. Das Abitur hatte ich ohne große Mühe mit 1,9 bestanden. Nun stand mir nur noch eines vor Augen: Der Eintritt. Ich hatte den 9. August gewählt, den Gedenktag der vor kurzem heiliggesprochenen Edith Stein. Auch wenn ich mich nicht mit ihr messen konnte, war sie mir doch ein Vorbild. Sie widerlegte das Klischee der ungebildeten, unselbständigen und lebensunfähigen Klosterschwester, das ich inzwischen leid geworden war. Sie hatte in Philosophie promoviert, war Assistentin bei Husserl gewesen, zum Katholizismus übergetreten und schließlich zur großen Verwunderung ihrer Freunde und Bekannten in den Karmel eingetreten.
Auch ich betrachtete mich nicht als unselbständig. Ich war nicht dumm und nicht fremdgesteuert. Ich wusste, was ich wollte und was ich tat, und jeder Schritt war reflektiert und gewollt. Ich war konvertiert und ging nach dem Abitur ins Kloster, nicht weil mir nichts Besseres eingefallen war oder ich mir nichts anderes zutraute, sondern weil ich es wollte. Und ich wollte es, weil Gott mich rief und es nichts Größeres in meinem Leben gab als ihn.
Am 8. August, dem Tag vor der Eintrittszeremonie, machten meine Eltern und Geschwister sich mit mir auf den Weg. Ich saß mit gemischten Gefühlen im Auto. Meine Koffer waren gepackt. Außer meinen Kleidern, meinem Sparbuch und ein paar Dokumenten und Büchern hatte ich nichts dabei. Viel war es nicht, denn viel würde ich ja nicht brauchen. Mein Klavier wurde zu einem anderen Zeitpunkt abgeholt. Der Gedanke, in wenigen Stunden für immer von meinen Eltern und Geschwistern Abschied nehmen zu müssen, vor allem von den beiden Kleinen, gab mir einen Stich ins Herz. Würde ich das überhaupt aushalten, diese familiäre Vertrautheit aufzugeben und endgültig in eine Welt von Erwachsenen überzusiedeln, wo es keine persönliche Nähe, keine Neckereien, keinen Unsinn gab? Schnell schob ich diese Fragen beiseite, denn ich hatte mir angewöhnt, mich von Fragen an die Zukunft, die per se unbeantwortbar waren, nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ich war überzeugt: Es wird sich alles geben. So schlimm kann es nicht sein. Andere haben es auch geschafft, und schließlich bin ich zu diesem Leben berufen, also werde ich auch die Kraft haben, es zu meistern. Und wenn es manchmal schwer sein wird, und das wird es mit Sicherheit, dann gehört das auch dazu, und ich werde es schaffen.
Den überwiegenden Teil der Fahrt schwebte ich aber in allergrößter Vorfreude. Ab morgen würde ich mit »Schwester« angesprochen werden. Ich würde ein Zimmer bekommen und einen Auftrag, einen festen Tagesablauf und eine neue Familie. Ich würde eine von ihnen sein und das tägliche Leben mit ihnen teilen. Vor allem aber kam ich jetzt Gott näher, denn ich kam an den Ort, an dem er mich haben wollte, an dem er etwas Großes mit mir vorhatte. Ich kam gewissermaßen in sein Haus, als seine Braut. Ich war aufgeregt und überglücklich. Wahrscheinlich gibt es nicht viele Möglichkeiten, wie man die eigene Existenz und Identität von heute auf morgen derart radikal ändern kann, wie ich das damals tat. Dafür muss man ins Kloster gehen – wenn nicht zum Militär oder ins Gefängnis.
Als wir im Mutterhaus ankamen, stellte sich heraus, dass die Gemeinschaft auf uns gewartet hatte. Um 17.30 beteten sie für gewöhnlich die Vesper, und mit dieser Vesper sollte ich begrüßt werden. Nun war es schon deutlich später. Ich bekam ein schlechtes Gewissen, weil sie auf uns gewartet hatten, obwohl wir nichts davon wussten. Schnell, fast hektisch, wurde ich in den Kreuzgang hineingezogen, in dem zwei Reihen von Schwestern im Chormantel standen. Die Pfortenschwester drückte mir einen Blumenstrauß in die Hand und flüsterte mir zu, ich solle ihn an Mutters Grab in der Klosterkirche ablegen. Da setzte sich der Zug auch schon in Bewegung. Mir war etwas mulmig zumute, bei dieser überfallsartigen Aktion. Die Geste mit dem Blumenstrauß kam mir ähnlich albern vor wie das rote Kreuzchen, und es störte mich, dass ich quasi dazu genötigt wurde, denn eine solche Geste hätte ja meiner eigenen Initiative entspringen müssen, um authentisch zu sein. Erst später stellte ich fest, dass der Blumenstrauß ein fester Bestandteil des Eintrittsrituals war. Trotzdem fand ss ich es auch Jahre später immer noch unauthentisch und albern fand. Dennoch machte ich gute Miene dazu und tat, was die Schwestern sich wünschten. Es gehört einfach dazu. Der unglaublich schöne Gesang in der Vesper, der Duft der Blumen in der Kapelle und die Willkommensworte in der Ansprache von P. Rektor ließen mich meinen Unmut schnell vergessen. Auch meine Eltern waren gerührt. Meine Schwester dagegen hatte gerade in diesem Moment schwere Augenblicke durchzustehen, was ich aber erst hinterher erfuhr. Sie war in einem bunten Top mit Spaghetti-Trägern gekommen, in dem die Schwestern sie nicht in die Klosterkirche lassen wollten. Sie wollten ihr eine Strickjacke aufzwingen, mit der sie ihre Schultern und Arme bedecken sollte, aber sie weigerte sich standhaft, sodass am Ende beide Seiten leicht frustriert waren, als sie es endlich geschafft hatte, doch mit ihrem Top in der Kirchenbank zu sitzen.
Читать дальше