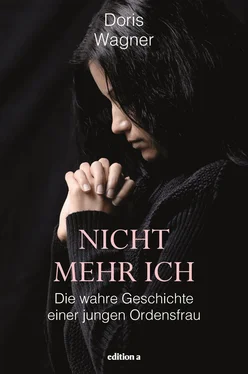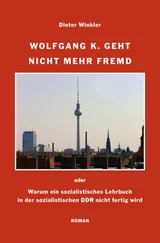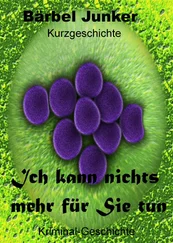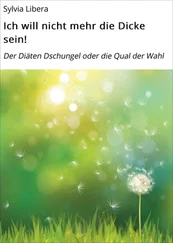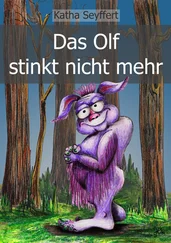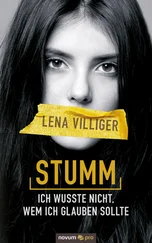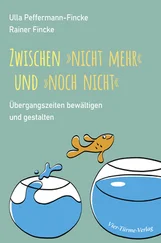Die Tage vergingen wie im Traum. Nur wenige Erinnerungen sind geblieben. Frater Anthony, ein junger Engländer mit rötlichem Haar, hatte in den Tagen vor unserer Ankunft ein von ihm selbst geschriebenes und inszeniertes Theaterstück aufgeführt, »Cullodum’s Moor«. Das Echo dieses Erlebnisses klang noch in den Tischgesprächen nach. Dass es in der Königsfamilie auch Mitglieder gab, die einen Sinn für Literatur und Kunst hatten und dass diese buchstäblich eine Bühne bekamen, machte einen großen Eindruck auf mich. Gerne hätte ich einige Worte mit ihm gewechselt und ihn nach dem Inhalt seines Stückes gefragt. Das gelang mir erst beim Abschied, als er nur mehr lächelnd antworten konnte: »Next time«. Dieses nächste Mal sollte nie kommen. Auch Sr. Theresia sollte ich in der Königsfamilie nicht mehr wiedersehen. Dafür sollten andere Dinge, die ich in diesen Tagen erlebte, in den folgenden Jahren mit größter Zuverlässigkeit immer wiederkehren, vor allem das Weihnachtsliedersingen, das bei diesem ersten Besuch besonderen Eindruck auf mich machte.
Nach dem Sonntags-Mittagessen wurden etwa DIN-A4-große Liederhefte verteilt, die Weihnachtslieder in den verschiedensten Sprachen enthielten: Latein, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Ungarisch, Slowenisch, sogar einige afrikanische Lieder waren dabei. Jeder durfte sich ein Lied wünschen, das dann von der ganzen Gemeinschaft mehrstimmig gesungen wurde. Jede Stimmung schien der Gemeinschaft zu gelingen, von alpenländisch, volkstümlich, über musicalhaft bis choralmäßig, gleich ob fröhlich, melancholisch oder kitschig-romantisch. Dieses gemeinsame Singen war ein starkes Gemeinschaftserlebnis. Ich fühlte mich aufgehoben und zugehörig, obwohl ich in den vergangenen Tagen niemanden aus dieser Runde persönlich kennengelernt hatte, mit niemandem wirklich gesprochen, niemandem von mir erzählt hatte. Die Tage vergingen mit Beten, Arbeiten, Ausflügen, Singen und Essen. Die Freundlichkeit der Patres, Brüder und Schwestern war überschwänglich, aber immer unpersönlich.
Ich kehrte von Rom sehr beglückt nach Hause zurück. Diese Tage im milden Klima des Südens unter jungen und fröhlichen Gottgeweihten, die verschiedene Sprachen sprachen und mich schon wie eine von ihnen behandelten, hatten die Kraft alle Schatten zu vertreiben, die das ein oder andere frühere Erlebnis mit der Königsfamilie auf meine Vorfreude geworfen hatte. Die Aussicht, bald in einem dieser Häuser wohnen zu dürfen, beflügelte mich. Etwas Schöneres konnte ich mir nicht vorstellen, und ich hielt mich für besonders gesegnet, weil Gott mich gerade in die Königsfamilie berufen hatte. Aber im Frühjahr 2003, einige Monate vor dem geplanten Eintritt, schien es dann doch, als ob Sr. Ottilie mit ihrer Ankündigung des Berufungskampfes recht behalten sollte.
In der Kollegstufe hatte ich einen besonders schlimmen Religions-Lehrer. Er vertrat nicht nur die gewöhnliche Palette kirchenkritischer Standpunkte, mit der sich die meisten der sogenannten aufgeklärten Katholiken schmücken, sondern er ging weit darüber hinaus. Er schien mich bewusst damit zu provozieren, dass er im Unterricht Videos mit Predigten von evangelischen Bischöfinnen vorspielte und Sätze wie diesen fallen ließ: »Die zwölf Stämme Israels hat es natürlich nicht gegeben, genauso wenig wie die zwölf Apostel.«
Ich war entrüstet und wartete immer öfter nach der Stunde auf ihn, um ihn persönlich zur Rede zu stellen. Empört schleuderte ich ihm entgegen: »Wie kommt es überhaupt, dass Ihnen Ihre Lehrerlaubnis noch nicht entzogen worden ist?!« Woraufhin er lächelnd antwortete: »Diese Frage werde ich mir in Gold einrahmen und an die Wand hängen!«
Wir begannen, uns außerhalb der Schule zu treffen. Auf unseren Spaziergängen versuchte ich ihm mit aller Überzeugungskraft, die ich nur aufbringen konnte, die Falschheit seiner Annahmen vor Augen zu führen. Er war in meinen Augen ein unglücklich Verirrter, den ich auf den rechten Weg zurückbringen wollte. Zugleich schmeichelte es mir, dass er mir tatsächlich zuhörte und sich mit meinen Thesen auseinandersetzte. Nicht Weniges von dem, was ich sagte, schien ihn tatsächlich nachdenklich zu machen, umgekehrt übrigens auch. Nicht dass er mich dazu gebracht hätte, meine Ansichten zu ändern, aber ich begann nachzudenken, um sie besser begründen zu können. Er sagte beispielsweise, er kenne keinen Grund, warum Frauen nicht Priester sein könnten, und meinte, meine Ablehnung wäre rein emotional: »Sie wollen sich eben nicht mit der Vorstellung einer Priesterin anfreunden«.
Das konnte ich so nicht stehen lassen, also begann ich nach überzeugenderen Gründen zu suchen, weshalb Frauen nicht Priester sein konnten, denn dass sie es nicht konnten, stand außer Frage. Es war die Lehre der Kirche. Andererseits konnte ich ihn dazu bringen, über die Anbetung und den Rosenkranz nachzudenken, ja ich schaffte es sogar, ihn zu überreden, auf einem unserer Spaziergänge einen ganzen Rosenkranz mit mir zu beten. Immer öfter kamen wir auch auf Persönliches zu sprechen. Er wollte wissen, wie es kam, dass ich dachte wie ich dachte, und er empfahl mir, nach dem Abitur – wenigstens ein paar Semester lang – Theologie zu studieren, »damit Sie Ihren Kinderglauben verlieren.«
Diese Formulierung entsetzte mich. Ich wollte meinen Glauben nicht verlieren, und das Kindliche daran schien mir nichts Schlechtes zu sein, im Gegenteil. Von da an war mir das Theologiestudium suspekt, und ich machte es dafür verantwortlich, dass junge gläubige Menschen reihenweise ihren ursprünglichen Glauben verloren und dann zu den schlechten Religionslehrern wurden, die wir an der Schule ertragen mussten. Nein, ich wollte nie Theologie studieren, vor allem nicht in Deutschland, wo die Professoren besonders gerne Kinderglauben zu zerstören schienen.
Er zögerte nicht, mir auch von sich zu erzählen. Er war Mitte dreißig, hatte Theologie und Anglistik studiert und über einen irischen Schriftsteller promoviert, von dem er mir einmal ein Buch zum Lesen gab, das mich wegen seiner beißenden Kritik am irischen Katholizismus erschreckte. Er verschwieg mir auch nicht, worunter er besonders litt: Er war Single. »Wenn ich mit vierzig noch nicht verheiratet bin, bringe ich mich um.«
Das berührte mich, und ich empfand stark, wie schlimm es sein musste, ab einem gewissen Alter noch allein zu sein. Dass er mit dieser Aussage eine bestimmte Reaktion in mir auslösen wollen könnte, kam mir nicht in den Sinn. Ich merkte nicht, dass sein Interesse bald nicht mehr dem Inhalt unserer Gespräche galt, sondern mir. Auch nicht als er begann, meine Berufung infrage zu stellen. Er gab mir Erfahrungsberichte von Frauen zu lesen, die nach einigen Jahren im Kloster gegangen waren, und er polemisierte gegen die Königsfamilie. »Schau dir die Schwestern an. Die sind nicht glücklich!«, sagte er zu mir.
Diese Äußerung ließ ich nicht gelten, schließlich kannte ich die Schwestern besser als er. Die Artikel, die er mir zu lesen gab, enttäuschten mich beinahe. Ich hatte mit substanziellerer Kritik gerechnet (die ich natürlich auch zurückgewiesen hätte). Seine Kritik an meiner Berufung schlug ich seiner allgemeinen Kirchenkritik zu. So fiel ich aus allen Wolken, als er eines Tages, als wir nach einem längeren Spaziergang zusammensaßen, mitten im Gespräch meine Hände nahm, mir in die Augen sah und sagte: »Ich liebe dich.«
Ich fühlte mich wie im falschen Film und spürte einen Impuls zur sofortigen Flucht. Aber ich blieb sitzen und hörte mir an, was er zu sagen hatte. Erst jetzt merkte ich, wie hoffnungslos verliebt er war – in mich! Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Dennoch ließen mich seine Worte nicht kalt. Die langen persönlichen Gespräche mit ihm hatten ihre Spuren in mir hinterlassen, und sein Liebesgeständnis bewegte mich mehr, als mir lieb war. Er hatte damit abgewartet, bis der reguläre Unterricht zu Ende war, was es mir keineswegs leichter machte, da gerade die Abi-Prüfungen begannen. Ich erbat mir von ihm eine Zeit des Abstands. Ich musste die Prüfungen hinter mich bringen und mir darüber klar werden, was seine Zuneigung zu mir zu bedeuten hatte.
Читать дальше