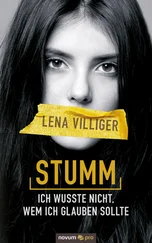Aber ich besann mich. Ich hatte ab jetzt kein Recht mehr auf das, was mir gehörte. Und das leuchtete mir ja auch ein. Während Sr. Ana mit meinen Kleidern verschwunden war und andere, schwesterntaugliche holen wollte, saß ich auf meinem Bett und dachte nach. Indem ich mich für das gottgeweihte Leben entschieden hatte, dem Ruf Jesu gefolgt war, gehörte ich nicht mehr mir selbst. Ich hatte mich ihm übergeben, bedingungslos, in dem kindlichen Vertrauen, dass alles, was er von mir fordern würde, mir nicht schaden, sondern mich ihm näher bringen würde. Nur wenn ich den Weisungen meiner Verantwortlichen folgte, und seien sie noch so banal, nur wenn ich auf mein Eigentum verzichtete und aufhörte an mich selbst zu denken, würde ich zu dem werden, was er von mir wollte. »Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir«. Das war mein Lebensprogramm. Das wollte ich tun. Wie konnte ich da an meinen Kleidern hängen? Ich beschloss, tapfer zu sein. Das hatte ich auch bitter nötig, als Sr. Ana mit ein paar prallgefüllten Plastiksäcken vom Dachboden wiederkam. Ich musste mich ausziehen und Stück für Stück Röcke und Blusen anprobieren, die wer weiß woher kamen. Entweder aus dem Nachlass verstorbener Wohltäterinnen, so mutmaßte ich, oder es waren Ladenhüter, die gespendet worden waren. Wadenlange karierte Faltenröcke, ärmellose Strickjacken in schrecklichen Beigetönen. Diese Sachen hätte meine eigene Großmutter nicht getragen. Ich fühlte mich schrecklich. Wäre Sr. Ana nicht so unschuldig gewesen (mir war klar, dass sie auch nichts für die Vorschriften konnte und dass sie nicht wusste, was sie mir da gerade antat), wäre ich wohl in wütendes Schluchzen ausgebrochen. Ich konnte mich gerade noch zusammennehmen. Nicht ich, sondern sie entschied, welche Dinge ich behalten sollte. Das einzige Kriterium dafür schien zu sein, ob sie mir passten. Dabei hatte Sr. Ana eine andere Vorstellung von »passen« als ich, denn fast alles, was sie mir gab, war mir ein bis zwei Nummern zu groß. Ich kam mir vor, als würde ich in Säcke gehüllt. Schließlich erriet ich auch, wozu das gut sein sollte, denn bevor sie ihre Sachen wieder zusammenpackte, drückte sie mir noch weiße Baumwollunterwäsche und einen großen Stapel Unterkleider in die Hand, mit der Bemerkung: »Wir tragen das für unsere Mitbrüder«.
Ich verstand nicht sofort. Sr. Ana erklärte es mir etwas umständlich, indem sie mir von einem Priester erzählte, der vor Kurzem im Mutterhaus auf Besuch gewesen sein musste. »Wenn alle Frauen so gekleidet wären wie Sie«, habe er gesagt. Mehr sagte Sr. Ana nicht, aber das genügte, damit ich erraten konnte, was sie meinte. Indem wir unsere Körper so gut wie möglich in Unterkleidern und viel zu weiten Röcken, Blusen und Strickjacken versteckten, schützten wir unsere Mitbrüder vor der Versuchung, der sie ausgesetzt wären, wenn unsere Kleidung die Weiblichkeit unserer Körper sichtbar gemacht hätte. Das kam mir zuerst ziemlich bizarr vor. Aber ich dachte nicht weiter darüber nach.
Als ich alleine mit den »neuen« Kleidern im Zimmer saß und Namensschildchen in jedes einzelne Stück einnähte, wie Sr. Ana mir geheißen hatte, war ich völlig aufgewühlt. Zorn, Wut, Hilflosigkeit, Rätselraten über die Versuchung, die ich darzustellen schien – alles ging wild durcheinander und schlug hohe Wellen. Zugleich rang ich darum, tapfer zu sein, klar zu sehen und möglichst alles richtig zu machen. Es war die erste Krise, die ich in der Königsfamilie durchlebte, und es war die lebhafteste für eine lange Zeit, denn meine menschlichen Instinkte waren noch nicht völlig getrübt. Ich hatte noch ein Gefühl dafür, dass ich etwas wert war und dass man nicht alles mit mir machen durfte. Ich vergoss sogar einige Tränen. Letztendlich aber siegte der Entschluss zur Tapferkeit. Ich dachte mir: »Von ein paar hässlichen Kleidern werde ich meine Berufung nicht infrage stellen lassen. Wenn sie die Bedingung dafür sind, dass ich als Schwester in der Königsfamilie leben kann, dann will ich sie wie ein Hochzeitskleid tragen.« Als ich mich so weit durchgerungen hatte, setzte ein regelrechtes Hochgefühl ein. Ich war mir bewusst, dass ich meine erste echte »Berufungskrise« durchgestanden hatte.
In den folgenden Sommerwochen war ich sehr glücklich. Alles war noch neu und beeindruckend. Das gemeinsame Stundengebet, die vielen mehrstimmigen Lieder in verschiedenen Sprachen, der klare Tagesablauf. Die morgendlichen Kurzpredigten der Patres schienen jede für sich eine kleine Offenbarung, ein kostbares Geschenk für den Tag, ebenso wie die Frühstücksvertiefungen der Mitschwestern. Mein Tag war voller Sonnenschein und Frieden. Keine unzufriedenen Gesichter um mich, kein Streit, kein Lärm, keine Aufregung. Alles vollzog sich in wohlgeordneten, stillen Bahnen. Die gemeinsame Arbeit und das Essen waren von einer heiteren Ruhe, von einer – wie ich meinte – tiefen, inneren Fröhlichkeit der Mitbrüder und Mitschwestern überstrahlt. Gottes Gegenwart war spürbar. Mir fehlte nichts, obwohl mein Leben sich radikal geändert hatte: Kein Fernsehen, kein Radio, keine Zeitungen störten die heitere Ruhe der Hausgemeinschaft. Bücher, Spaziergänge, Klavierspielen, vieles von dem, was vorher so wichtig für mich gewesen war, gab es nicht mehr. Mein Leben war ganz Gebet und Arbeit. Ich meinte zu spüren, dass dadurch ein tiefer innerer Frieden in mir einkehrte. Es war ein Gefühl, als befände ich mich in einer permanenten Meditationsübung, die darin bestand, nichts mehr zu wollen, nichts mehr aus eigenem Antrieb zu tun, sondern mich ganz dem zu überlassen, was mir für jeden Moment aufgetragen war, um darin Gott zu begegnen.
Mein Tag war völlig ausgefüllt, von 6:00 am Morgen bis 21:00 am Abend. Wenn man hinzufügt, dass wir vor 6:00 und nach 21:00 auf unseren Zimmern sein sollten, kann man sogar sagen, dass ich über keine Minute meines Lebens mehr selbst bestimmte. Alles, was ich tat, wurde von anderen bestimmt und vorgegeben. Ich tat nichts mehr aus eigenem Antrieb, und ich war nie alleine. Auch verließ ich alleine das Kloster nicht mehr, obwohl ich wie alle einen Schlüssel hatte, denn ich hatte nicht nur keine Zeit, sondern auch keinen Grund, das Haus zu verlassen. Sobald ich abends alleine in meinem Zimmer war, ging ich schlafen. Auf einen anderen Gedanken wäre ich auch nicht gekommen, denn erstens waren die Möglichkeiten, alleine im Zimmer noch etwas zu tun, sehr beschränkt (Bücher durften wir nicht haben), und zweitens war ich nach dem langen Tag extrem müde. Müdigkeit wurde in den folgenden Jahren in der Königsfamilie mein permanenter Begleiter.
Das Einzige, was mich in diesen ersten Wochen beunruhigte, war, dass ein Gespräch über meine Zukunft, ein richtiger Auftrag und eine richtige Verantwortliche auf sich warten ließen. Ich beschloss, diese Zeit der Ungewissheit zu einer Übung in der Tugend der Geduld zu machen und mich mit dem zufriedenzugeben, was in der Zwischenzeit galt. Mir wurde gesagt, dass Sr. Luisa, eine große schlanke Norddeutsche mit dünnem braunen Haar, die Lokalverantwortliche wäre und ich mich an sie wenden sollte, wenn ich praktische Fragen hätte. Außerdem sollte ich sie ansprechen, wenn ich beichten wollte. Dann würde sie einen Mitbruder fragen und einen Beichttermin für mich bei ihm ausmachen. Zur Arbeit wurde ich fürs Erste in der Küche eingeteilt. Sr. Ivana, die Verantwortliche in der Küche, gab mir eine typische Anfängeraufgabe: den Frühstücksdienst. Das bedeutete, dass ich mindestens den ganzen Vormittag und oft auch noch einen Teil des Nachmittages damit zubrachte, die Reste des Frühstücks zusammenzuräumen und alles für das Frühstück am nächsten Tag vorzubereiten. Im Schnitt frühstückten dort im Sommer um die 50 Personen. So, wie es mir gezeigt wurde, kratzte ich die Marmeladenreste aus den einzelnen Schälchen vom Morgen zusammen, spülte die Schälchen und füllte sie wieder. Mit den Butterresten verfuhr ich ebenso. Die weichen Reste wurden in einen Eisschöpfer gestrichen und zu kleinen Butterkugeln »verkugelt«, ein Verfahren, das mich erstaunte, das die Schwestern aber ganz selbstverständlich praktizierten. Die neuen Butterschälchen wurden dann teils mit den Butterkugeln aus den Resten vom Morgen, teils mit frischen Stücken Butter belegt, bevor das alles auch in den Kühlschrank wandern konnte.
Читать дальше