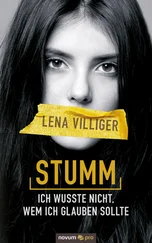Meine Familie war im Familienhaus untergebracht, einem hübsch renovierten Bauernhof in Hanglage, der seit den 1920ern zum Mutterhaus gehörte. Das Haus diente als Gäste- oder Exerzitienhaus. Wie viel dieser Besitz in den 20ern wert war, vermag ich nicht zu schätzen. Heute aber ist ein solches Grundstück in dieser Lage, wo 1m 2schon mal um die 900 Euro kosten kann, unbezahlbar. Das alles wusste ich nicht, als ich das erste Mal das Haus und die Aussicht bewunderte. Meine Familie fühlte sich dort wohl. Zwei Schwestern wohnten dort und sorgten sich gemeinsam mit Sr. Ottilie, die ebenfalls dort untergebracht war, um meine Familie, bevor sie am nächsten Morgen zu meiner Eintrittsfeier hinunter ins Kloster fuhren.
Die Messfeier fand in der kleinen Kapelle statt, in der ich auch das rote Kreuzchen empfangen hatte. An einem bestimmten Punkt der Feier sollten meine Eltern und ich je ein vorformuliertes Gebet sprechen, das uns zuvor von Sr. Ottilie in die Hand gedrückt worden war. Ich überflog den Text und fand, dass ich mich weitgehend damit identifizieren konnte. Vor Beginn der Messfeier legte ich das rote Kreuz ab. Ich war froh, es nicht mehr tragen zu müssen. Als alle sich erhoben, die Schwestern den Gesang anstimmten und der Priester den Raum betrat, war ich etwas enttäuscht. Es war nicht P. Rektor, sondern P. Jodok, ein kleiner, leicht rundlicher Vorarlberger um die 40, der mir bisher noch kaum aufgefallen war. Immerhin hatte er extra für meinen Eintritt eine Predigt vorbereitet, die mir aber größtenteils unbewusst blieb, bis auf eine Formulierung, die mir merkwürdig vorkam: dass ich »eine würdige Tochter von Mutter werden möge«. Ich kannte diese »Mutter« ja kaum. Nichts von dem, was ich bisher von ihr gehört hatte, hatte es mir möglich gemacht, eine Art innerer Beziehung zu ihr aufzubauen. So gelang es mir nicht, mich als ihre »Tochter« zu fühlen, und ich konnte mir nicht vorstellen, was es heißen sollte, ihrer »würdig« zu sein. Naja, dachte ich, das alles werde ich ja jetzt, wo ich zur Königsfamilie gehöre, sicher erfahren. Ich sprach mein Gebet mit klarer Stimme, als aber meine Eltern an der Reihe waren, blieben meiner Mutter vor lauter Schluchzen beinahe die Worte im Hals stecken, besonders an der Stelle, wo sie Gott dafür dankten, dass er mich ihnen geschenkt hatte und dass sie mich ihm jetzt wieder zurückschenkten. Ich wusste, dass meine Mutter mich ungern »hergab«, so stolz sie auch auf meine Berufung war.
Nach der Messe standen alle im Gang und gratulierten mir und meinen Eltern. Danach gab es im Konferenzzimmer ein festliches Mittagessen für meine Familie sowie ein paar Patres und Schwestern. Erst am Nachmittag bekam ich eine letzte Gelegenheit, mit meiner Familie allein zu sein. Das heißt, während meine Eltern ein »Glaubensgespräch« mit einem der Priester im Haus führten, durfte ich mich mit meinen Geschwistern und etwas Spielzeug für die Kleinen in eines der Empfangszimmer zurückziehen. Das Herz wurde mir schwer. Ich dachte daran, dass ich sie zum letzten Mal um mich hatte und wir uns ab morgen nicht mehr sehen würden. Ein Eintritt ins Kloster bedeutete den endgültigen Abschied von der eigenen Familie, es konnten Jahre vergehen, bevor man sich wiedersah. Das schien mir logisch. Bei Theresia von Lisieux war es auch so gewesen. Ich hatte nun eine »neue Familie« und es war nicht mehr meine Entscheidung, sondern die meiner Verantwortlichen, ob und wann ich meine Familie wiedersehen würde. Meine Schwestern wehrten sich. »Wir sind deine Schwestern und nicht die da«, sagten sie mir, und »wie kannst du es hier nur aushalten?« Sie fanden das Kloster und die Schwestern schrecklich, und als sie sich über Einzelne von ihnen lustig machten, konnte ich nicht anders als mitlachen. Aber das änderte natürlich nichts an meinem Entschluss.
Am nächsten Morgen reiste meine Familie ab. Ich hatte mich schon am Abend zuvor kurz von ihnen verabschiedet, wusste aber nicht, dass meine Mutter noch einmal mit mir hätte sprechen wollen, dass sie am Tag der Abreise mit einer schlimmen Migräne erwachte und Sr. Ottilie sie unbarmherzig zum Aufbruch drängte. Wie hätte ich das auch erfahren sollen? Meine Mutter erzählte es mir erst Jahre später, nach meinem Austritt.
Für mich begann der Tag nach dem Eintritt mit dem gewohnten Programm: um 6.00 Morgengebet, 6.15 Messe, 7.00 Lesehore und Laudes, danach das typische spartanische Frühstück mit dünnem Kaffee, Milch, vom Bäcker geschenkten alten Brötchen, Butter und Marmelade. So bescheiden das auch war, es machte mich glücklich. Jeder Ton, jeder Geruch, jeder Augenblick dieses Klosterlebens war mein neues Leben, zu dem Gott mich gerufen hatte. Alles wurde zu einem Zeichen seiner Liebe zu mir.
Nach dem Frühstück wurde ich mit Sr. Kerstin zum Autoputzen eingeteilt. Das Kloster hatte einen Fuhrpark, der aus einigen mehr oder weniger bescheidenen Autos bestand. Wir putzten an diesem Vormittag zwei von ihnen gründlich, wobei ich versuchte, mein Bestes zu geben. Denn das hatte ich schon verstanden: dass Schwestern beim Putzen sehr viel schärfere Maßstäbe anlegen als gewöhnliche Menschen. Ich putzte also viel gründlicher, als ich es für nötig gehalten hätte, und schien damit richtig zu liegen. Wir sprachen wenig miteinander und ich fragte mich, was nun auf mich zukommen würde. Ich war eingetreten, aber wie würde es nun weitergehen? Bisher hatte niemand mit mir darüber gesprochen, und was ich wusste, war wenig. Ich wusste, dass ich eine Art Ausbildungszeit durchlaufen würde, in der es irgendwann ein Noviziat und ein »Heiliges Bündnis« gab und dass ich eine Verantwortliche haben würde, die mich »ins Charisma einführt« und begleitet. Aber konkret hatte noch niemand mit mir darüber gesprochen. Was würde ich morgen tun? Und wann würde ich einen festen Auftrag bekommen? Vor allem aber: wer würde meine Verantwortliche sein? Und ob ich wohl in ein anderes Zentrum versetzt werden würde, vielleicht nach Rom? Das wagte ich gar nicht zu hoffen. Eines aber stand für mich ohnehin fest, was auch immer kommen würde, es würde der Wille Gottes sein, und ich war fest entschlossen, es anzunehmen und mit all meinen Kräften zu erfüllen.
Meine Entschlossenheit wurde schon bald auf eine unerwartete Probe gestellt. Ich erfuhr, dass meine Kleider durchgesehen werden müssten. Das würde bei allen jungen Schwestern nach dem Eintritt geschehen. Nichtsahnend und frohgemut wartete ich an einem sonnigen Nachmittag in meinem kleinen Zimmer auf Sr. Ana, die diese Aufgabe übernehmen sollte. Sie würde kaum etwas aussortieren müssen, dachte ich, denn ich hatte mich ja schon jahrelang wie eine Schwester gekleidet: keine Hosen, keine knalligen Farben, keine kurzen Ärmel, nur Röcke und Blusen. Umso blasser wurde ich, als ich, auf dem Bett sitzend, zusehen musste, wie Sr. Ana ein Kleidungsstück nach dem anderen aus meinem Schrank nahm und sagte: »Nein, das geht nicht. Das auch nicht«. Es schien kein Ende zu nehmen. Als sie auch die Jacke meines Konfirmationsanzuges aussortierte, war ich den Tränen nahe. Da begann Sr. Ana mir zu erklären, warum ich diese Dinge nicht tragen könnte. Dass sie dabei lächelte, machte es nicht besser. Manchmal war es die Farbe: »Mutter Marozia wünscht nicht, dass wir rot tragen«, oder es war der Schnitt, »tailliert, das passt nicht für eine Schwester«, oder es war der fehlende Kragen oder ein Ausschnitt an meinen Blusen, denn Schwestern trugen nur Blusen, die sich bis zum Kehlkopf zuknöpfen ließen.
Schließlich blieben von all dem, was ich im Schrank gehabt hatte, nur zwei hellblaue Blusen und ein blauer Rock, der aber noch gekürzt werden musste, denn er war knöchellang, und auch das gefiel Mutter Marozia anscheinend nicht. Sie schien der Maßstab in Kleiderfragen und überhaupt allem zu sein. Für Röcke galt nun einmal, dass sie wadenlang sein mussten, am besten »18 Zentimeter vom Boden«. Ich war zerknirscht. Vielleicht wollte Sr. Ana mich aufmuntern, als sie mir sagte, meine Sachen »können wir ja unseren Katakombenfamilien weitergeben, die können so etwas tragen«. Tatsächlich gab sie mir mit diesem Satz einen Stich ins Herz. Es waren ja meine Sachen, die sie fortgeben wollte.
Читать дальше