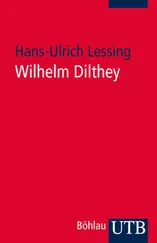Die Gerichtsthematik
3. Die Redaktion von Q
Q als Komposition
Ein Blick auf die zuvor genannten Einheiten zeigt, dass es sich wenigstens z. T. um thematisch geordnete Zusammenstellungen von Einzelworten handelt, so dass auf der Ebene von Q bereits eine gewisse Komposition der Worte Jesu vorgenommen worden sein muss. Da sowohl Verbindungen zwischen Worten als auch Interpretationen älterer Worte durch (jüngere) Zusätze erkennbar sind und manche Motive und Tendenzen mehrfach begegnen, ist es möglich, nach den leitenden Prinzipien dieser Komposition und Redaktion zu fragen und die einzelnen Quellen sowie die Zusätze bestimmten Schichten zuzuweisen.
Hypothetischer Charakter
Schichtenmodell
Dies ist im Grunde derselbe Vorgang wie in der redaktionskritischen Exegese der Evangelien, nur dass die Ergebnisse dieser Arbeit an der Logienquelle schon angesichts der Tatsache, dass uns diese nur als Rekonstruktion vorliegt, noch hypothetischer sind als bei den Evangelien. Es entbehrt auch nicht einer gewissen Komik, dass die wörtliche Rekonstruktion der Quellenvorlagen der Evangelisten in der Forschung in den letzten Jahrzehnten weitgehend aufgegeben worden ist (jüngste Ausnahmen bestätigen nur die Regel!), die Frage nach verschiedenen Quellenschichten und deren Textgrundlage in der Logienquelle aber zur gleichen Zeit fröhliche Urständ feiert.
Wie problematisch die Differenzierung von Q in bestimmte Schichten im einzelnen ist, kann man sich an folgendem Beispiel verdeutlichen: Die Annahme, dass das Selbständigwerden der Jesusbewegung ein allmählicher Prozess war und dass diese Wachtstums-Entwicklung sich auch in der „Literatur“ dieser Bewegung niedergeschlagen hat, ist von vornherein wahrscheinlich. Insofern ist die Überlegung durchaus plausibel, dass die ursprünglich vorhandene Nebeneinanderordnung von Jesus und Johannes dem Täufer allmählich zugunsten einer Überordnung Jesu abnahm. Deswegen besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Aussagen, die Johannes und Jesus gegeneinander profilieren und Jesus den Vorrang einräumen, später sind als die Aussagen, die beide eher auf einer Ebene sehen. Problematisch dabei ist nur, dass hier von einer einsträngigen und einheitlichen Entwicklung ausgegangen wird, genau so, wie man das bei der Trennung der Jesusbewegung vom Judentum gemacht hat. Wie aber das Verhältnis zum Judentum sich in den einzelnen Gemeinden der Jesusbewegung unterschiedlich entwickelt und die Trennung deswegen zu unterschiedlichen Zeiten stattgefunden hat, kann sich auch das Verhältnis der Jesusbewegung zum Täufer und dessen Jüngern an unterschiedlichen Orten unterschiedlich entwickelt haben. Von daher ist die zeitliche Nachordnung der kritischen Worte über den Täufer hinter die unkritischen keineswegs sicher und insofern die ganze Rekonstruktion stark hypothetisch. Damit soll keineswegs das Recht entsprechender Versuche in Frage gestellt werden, sondern nur Verständnis für den stark hypothetischen und insofern auch umstrittenen Charakter der in Frage stehenden Untersuchungen geweckt werden.
Angesichts dieser Schwierigkeiten überrascht es nicht, dass einzelne Traditionen in der Überlieferungsgeschichte der Logienquelle ganz unterschiedlich eingeschätzt werden. So wird z. B. Lk 16,17 von Kloppenburg (Formation) der jüngsten Schicht von Q zugewiesen. Diese Einschätzung ist aber keineswegs allgemein anerkannt, Lk 16,17 kann auch der ältesten Schicht von Q zugewiesen werden (vgl. Horn 347352) – die Zugehörigkeit einzelner Stücke von Q zu bestimmten Schichten ist also weiterhin im Fluss.
Sachliches Ordnungsprinzip
Diese Arbeit vermag freilich auch zu gesicherten Ergebnissen zu führen, sonst könnte nicht über die Tatsache Einigkeit bestehen, dass Q den beiden Evangelisten bereits in einer nach bestimmten Kriterien erfolgten Ordnung vorgelegen hat.
Q war also keine mehr oder weniger zufällige lose Sammlung von Einzelworten, sondern war bereits nach sachlichen Gesichtspunkten gestaltet. Diese sachliche Ordnung ist nicht, wie man vermutet hat, gattungsbedingt.
Denn beim Thomas-Evangelium, einem von der Gattung her ähnlichen Exemplar einer Sammlung von Jesusworten, konnte man eine solche Ordnung jedenfalls bislang nicht feststellen.
Gattungsfrage
Die Frage, wie die Q vorausgehenden Teilsammlungen form- und gattungskritisch einzustufen sind, hat die Forschung an Q in der letzten Zeit stark bestimmt, sie ist aber offensichtlich ebenso schwierig zu beurteilen wie deren Anzahl, die in der Literatur bis zu fünf gehen kann. In der Regel begnügen sich die Autoren mit der Annahme von drei Redaktionen: Einmal der Sammlung der Grundschrift (vielleicht noch in aramäischer Sprache), dann einer Übersetzung und ersten Ergänzung dieser Grundschrift und einer abschließenden Redaktion im judenchristlich-hellenistischen Raum. Dass Q zahlreiche ► Weisheitsworte enthält, ist unbestritten, ob aber auch von einer starken weisheitlichen Prägung der Grundschrift auszugehen ist, ist unsicher. Da neben den weisheitlichen Elementen auch prophetisch-apokalyptische in Q vorhanden sind – auch diese sind übrigens als Charaktistikum der Grundschrift angesehen worden – und der eschatologische Charakter Jesu als Lehrer wohl noch stärker betont ist als der als Weisheitslehrer, sollte man besser keinen strengen Gegensatz zwischen einer weisheitlichen und einer prophetischen Grundschicht aufbauen. Beide Strömungen haben den Sammlungs- und Bearbeitungsprozess von Q beeinflusst. Neben den weisheitlichen und prophetisch-apokalyptischen Stücken finden sich in Q darüber hinaus noch Regeln für Missionare und Märtyrerparänese sowie apologetisch-polemische Stücke.
Da Q auch mit dem ► Kynismus in Zusammenhang gebracht worden ist, nimmt es nicht wunder, dass die Gattungen der Teilsammlungen auch als von außerisraelitischer Literatur beeinflusst angesehen wurden. Zeller hat aber gezeigt, dass sowohl ein Heranziehen der altorientalischen Instruktionen als auch der griechischen ► Gnomologien unnötig ist. Die Komponenten des Weisheitsbuches oder des Buches Jesus Sirach reichen aus, um die Q zugrundeliegenden Teilsammlungen der Herrenworte zu erklären (Zeller, Grundschrift 400 f.).
Kynische Beeinflussung
4. Ursprüngliche Reihenfolge und ursprünglicher Wortlaut
Lk mit ursprünglicher Reihenfolge und besserem Wortlaut
Die Ansicht, dass Lukas in seinem Evangelium die Reihenfolge und den Wortlaut von Q besser erhalten hat als Matthäus, ist in der Q-Forschung allgemein akzeptiert. Für diese These spricht zum einen, dass das beiden Evangelien gemeinsame Material bei Lukas im wesentlichen in den beiden großen Einschaltungen in den Markuszusammenhang von 6,20–8,3 und 9,51–18,14 begegnet, während es bei Matthäus über das ganze Evangelium verstreut ist. Zum anderen bringt ein Vergleich zwischen den Evangelien nach Matthäus und Markus die Tendenz des Matthäus an den Tag, sein Material aus verschiedenen Quellen zusammenzutragen und es zu thematischen Blöcken zusammenzufassen (vgl. nur Mt 8 und 9 mit den Markusparallelen). Dies ist bei Lukas nicht in vergleichbarer Weise der Fall. Darüber hinaus spricht auch der Umstand, dass Lukas im Gegensatz zu Matthäus die Markus-Reihenfolge nur in geringem Umfang geändert hat, für die größere Ursprünglichkeit der lukanischen Reihenfolge auch beim Material der Logienquelle. Diese wird deswegen in der Q-Forschung nach der lukanischen Zählweise mit dem vorangestellten Kürzel Q zitiert.
Nicht völlig identische Versionen von Q?
Die Ursachen für die Abweichungen der beiden Evangelisten im gemeinsamen Q-Stoff werden in der Literatur unterschiedlich beantwortet. Während die einen diese auf die jeweils unterschiedliche Redaktion des gemeinsamen Stoffes durch die Evangelisten zurückführen, gehen andere von zwei insgesamt nicht völlig identischen Versionen der Logienquelle aus (Q Mtund Q Lk). M. E. schließt die eine Möglichkeit die andere nicht aus. Es gibt wirklich gravierende Gründe, z. B. bei den Seligpreisungen (Q 6,20 ff) oder beim Gleichnis von den Minen (Q 19,12–26) eine jeweils unterschiedliche Gestalt der Vorlage anzunehmen. Gleichzeitig gibt es aber ebenfalls gute Gründe für die Annahme, dass Matthäus und Lukas die Worte der Logienquelle mehrfach nicht wörtlich aus der Quelle in ihr Evangelium übernommen haben. Andernfalls hätten sie sich dann diesem Stoff gegenüber ganz anders verhalten als gegenüber der Markusvorlage! Insofern dürften die Unterschiede zwischen dem Matthäus- und Lukasevangelium im gemeinsamen Q-Stoff sowohl mit einer z. T. unterschiedlichen Gestalt von Q als auch mit der Redaktionsarbeit der beiden Evangelisten zusammenhängen. Im übrigen ist damit zu rechnen, dass auch die Übernahme des Materials der Logienquelle in den größeren Zusammenhang eines Evangeliums zu Veränderungen des Materials führen musste. So werden v. a. die Einleitungen der Worte verändert worden sein, wie überhaupt zu fragen ist, wie Anfang und Ende der Sammlung ausgesehen haben. Es wird in der einschlägigen Forschung damit gerechnet, dass die Sammlung ein Präskript und evtl. auch ein Schlusswort gehabt hat, das aufgrund der Übernahme der Logiensammlung in die Evangelien nicht mehr erhalten ist.
Читать дальше
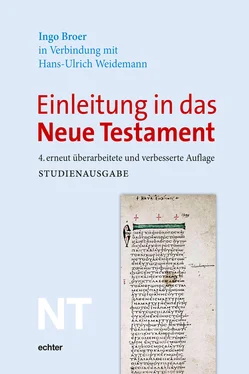
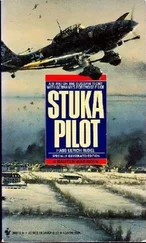


![Felix Sobotta - Das alte Jagdschloss und das neue Haus [Band 1]](/books/493473/felix-sobotta-das-alte-jagdschloss-und-das-neue-ha-thumb.webp)