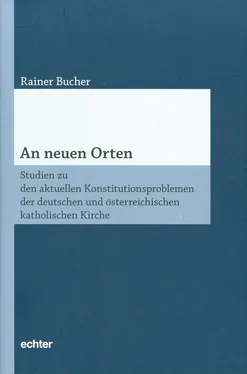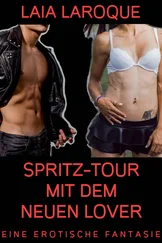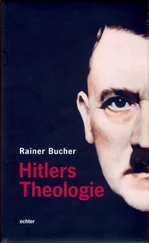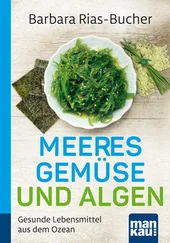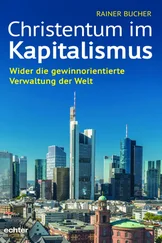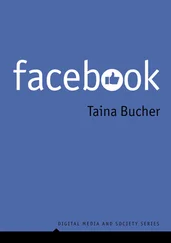Gegenüber der konziliaren Trias von Volk-Gottes-Theologie, gesamtheitlichem, existenzlegitimierendem Pastoralbegriff und pastoraler „Zeichen der Zeit“-Orientierung wirkt der c. 517 § 2 nun aber wie der ebenso ungeliebte wie ein wenig überraschende Versuch des Kirchenrechts, die de facto Vernachlässigung der Volk-Gottes-Theologie im CIC 1983 durch einen explizit nicht-theologischen, rein pragmatisch 346begründeten Öffnungsbeschluss an sensibler Stelle ein klein wenig zu relativieren.
Denn natürlich würde spätestens die offiziell nicht vorgesehene, hier und da aber versuchte 347relativ weiträumige Anwendung des c. 517 § 2 die Erlebnisrealität kirchlichen Handelns – zumindest in Europa 348– massiv verändern und einen Hauch von Volk-Gottes-Realität in den kirchlichen Innenbereich wehen lassen.
5 Perspektiven einer zukünftigen Sozialgestalt von Kirche
Pastoraltheologie ist als gegenwartsorientiertes und risikoreiches Fach auf der Schwelle zur Zukunft 349eine jener theologischen Disziplinen, die Musils berühmten „Möglichkeitssinn“ nicht nur entwickeln darf, sondern muss. Nun gilt zwar, dass die Zukunft kaum je so unvorhersehbar gewesen sein dürfte wie gegenwärtig, da sie weder mehr, wie vor der Moderne, die Verlängerung einer normierenden Vergangenheit, noch, wie modern, die Vorgeschichte einer glorreichen Zukunft, sondern voller Überraschungen ist, und zudem ist ziemlich unklar, wie, ja ob komplexe soziale Systeme überhaupt im größeren Ausmaß heute noch steuerbar sind 350und ein ziemlich neuen Kontextbedingungen ausgesetztes System wie die katholische Kirche gleich gar. 351Mit diesen Einschränkungen kann man aber natürlich schon fragen: Was ergibt sich aus dem bisher Gesagten für eine zukünftige Sozialgestalt der Kirche?
Erstens: Alle zukünftigen Sozialformen der Kirche werden davon ausgehen müssen, dass die Kirche nicht mehr die Herrin über die Partizipationsmotive ihrer eigenen Mitglieder ist und auch nicht mehr werden wird .
Dies erfordert eine grundlegende Transformation der kirchlichen Pastoralmacht und diese Transformation kommt einer Selbstüberschreitung gleich. In früheren Formen der kirchlichen Pastoralmacht hatte das totalisierende Element dominiert: Alles sollte unter die Pastoralmacht kommen, so in der Pianischen Epoche, oder es hatte, so in der Gemeindetheologie, das individualisierende Element in einer emanzipatorischen Variante dominiert: Das pastoraltheologische Stichwort hierfür lautete „Subjektwerdung“.
Heute aber ist das Selbstlosigkeitsmerkmal notwendig der Horizont aller kirchlichen Pastoral. Grundsätzlich interessiert sich auch heute noch Pastoral für jeden Einzelnen und jede Einzelne und grundsätzlich interessiert alles an ihr und an ihm. Aber diese beiden Merkmale verlieren den ambivalenten Horizont von „Überwachen und Bewachen“, den sie in der klassischen Pastoralmacht und ihrer agrarischen Hirtenmetapher 352hatten. Sie werden von Forderungen an andere – alle müssen alles in den Kontext der Religion einbringen – zu Anforderungen an die Kirche: Sie werden zur Aufgabe, niemandem und keinem seiner Probleme auszuweichen. Sie werden also von Zumutungen der Kirche an ihre Mitglieder zu Zumutungen der Menschen an die Kirche.
Zweitens: Die Kirche muss sich weitgehend erst noch jenes Instrumentarium bereitstellen, mit dem sie auf die Herausforderung ihrer epochalen Entmachtung in den Köpfen, Herzen und Hirnen ihrer eigenen Mitglieder reagieren kann. Der c. 517 § 2 ist vielleicht der allererste (und natürlich ungenügende) Vorschein davon .
Die katholische Kirche wird um eine grundlegende Umstellung ihres Steuerungsinstrumentariums und überhaupt schon ihres Steuerungsdenkens nicht herum kommen. 353Es wird nicht mehr länger zielführend sein, klassisch modern in Sozialformen und gar noch primär in Über- und Unterordnungskategorien zu denken und damit in einer institutionellen wie inhaltlichen Selbstverständlichkeitsfiktion zu verharren.
Der eigenen flüssigen Realität unter liquiden Kontextbedingungen wäre es angemessener, situativ, also im doppelten Index von Ort und Zeit, und dabei aufgabenorientiert zu denken und auf dieser Basis dann flexible Sozialformen seiner selbst zu entwickeln, in einem offenen Such- und permanenten Evaluationsprozess. In Anfängen ist das an der pastoralen Basis wahrscheinlich schon längst der Fall.
Drittens: Die Kirche wird unter den spätmodernen Bedingungen des religiösen Marktes viele differenzierte, vernetzte und konkurrenzfrei agierende Orte brauchen, wo sie sich ihrer pastoralen Aufgabe, der konkreten und kreativen Konfrontation von Evangelium und Existenz, stellt .
Der Weg von einer kirchlichen Konstitutionsstruktur, bei der vorgegebene Gemeinschaftsformen ihre Aufgaben suchen, zu einer Konstitutionsstruktur, deren Basis aufgabenbezogene, selbstlose Vergemeinschaftungsformen bilden, scheint die aussichtsreichsten Perspektiven zu bieten.
Das zentrale Merkmal vernetzter sozialer Strukturen ist die grundsätzliche Gleichrangigkeit der Vernetzungsknoten, die aufgabenbezogene Vernetzungsflexibilität und die weitgehende Vernetzungsautonomie, also das weit reichende Recht der einzelnen Orte, die eigenen Vernetzungsstrukturen selbst zu knüpfen und zu lösen. 354Die territoriale Fassung der kirchlichen Basisorganisation wird dann zentrales Element einer selbstlosen Angebotsstruktur der christlichen Botschaft, die auch dorthin geht, wo die Kirche endgültig alle religionsgemeinschaftliche Macht verloren hat. Der theologische Begriff für dieses selbstlose Angebot der Nähe Gottes in Wort und Tat aber heißt Gnade. 355Die bleibenden Aufgaben der Territorialpfarrei wären daher gnadentheologisch zu reformulieren.
6 Eine Perspektive für das Priestertum in der Gemeinde
Es bleibt noch die Frage nach einer Perspektive für das Weihepriestertum unter den Bedingungen der irreversiblen Freisetzung zu religiöser Selbstbestimmung, nach dem Scheitern der Gemeindetheologie und im Horizont der konziliaren Volk-Gottes-Ekklesiologie.
Die zentrale Frage lautet dabei: Wie kann das Weihepriestertum seine unverzichtbare Aufgabe im Volk Gottes jenseits seiner bisherigen massiv macht- und sanktionsgestützten Form erfüllen? Wie kann das geschehen, konkret erfahrbar, praxisrelevant und tatsächlich als Gnade für ihre Träger, die Priester, wie für das übrige Volk Gottes? 356
Nun sollte die innere Struktur der Kirche und ihrer einzelnen pastoralen Orte widerspiegeln, was sie in ihrer pastoralen Praxis verkörpern. Von daher wäre auch die Stellung des Weihepriestertums in der Gemeinde neu und primär gnadentheologisch zu entwerfen. Das würde auch der spezifischen Funktion des Weihepriestertums im Volk Gottes entsprechen. Wenn sich nämlich, wie Ottmar Fuchs formuliert, „die Kirche insgesamt der Gnade Gottes verdankt und damit seiner ‚Diakonie‘ den Menschen gegenüber, dann darf es als Spezifikum des Weiheamtes angesehen werden, genau dieser Vorgegebenheit Wirkung und Gestaltung zu ermöglichen.“ 357
Müsste dann nicht gerade die priesterliche Hierarchie im gegenwärtigen epochalen Transformationsprozess der kirchlichen Sozialformen für das radikale Vertrauen auf die Gnade Gottes in und mit seiner Kirche stehen? Müsste dann nicht gerade das Weihepriestertum für den von ihr und an ihr selbst gewagten Wandel stehen? Wäre das nicht gerade Teil seiner priesterlichen Aufgabe?
Es gibt in der Kirche, so Elmar Klinger, „eine jurisdiktionelle Ordnung und eine sakramentale Ordnung. Die jurisdiktionelle Ordnung ist standespolitisch bestimmt. Sie ist eine Standesordnung.“ Diese aber, so Klinger völlig zutreffend, „hat ihre Transparenz und Allgemeingültigkeit eingebüßt. Das Standesbewusstsein trägt wenig aus und geht fast überall verloren“. Das Verhältnis von Jurisdiktion und Sakramentalität habe „eine Geschichte und wurde in ihr sehr unterschiedlich gefasst.“ 358
Читать дальше