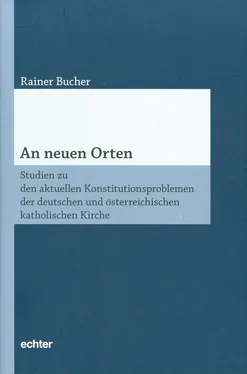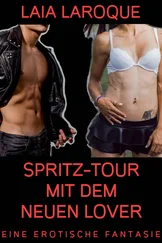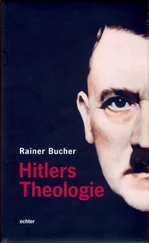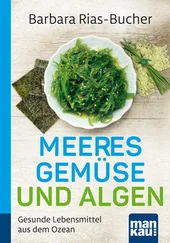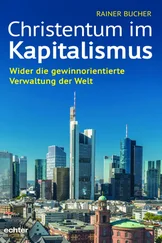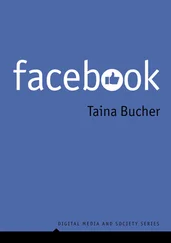Hier soll demgegenüber das Thema zeitlich und örtlich eingerenzt werden: Es wird im Folgenden um Europa und speziell den deutschsprachigen Raum der Gegenwart gehen. Dabei soll die Gemeindeleitungsproblematik in drei Kontexten betrachtet werden, die neben dem kirchenrechtlichen für Kirchenbildungsprobleme einschlägig sein dürften. 301Ich werde von „außen nach innen“ vorgehen und die Gemeindeleitungsproblematik zuerst in einen religionssoziologischen, dann in einen pastoraltheologischen und schließlich in einen systematisch-theologischen Kontext gestellt wird.
Religionssoziologisch wird es um die Frage nach dem aktuellen Wandel in den Vergesellschaftungsprozessen von Religion in Europa gehen, einem Wandel, der gerade die katholische Kirche und ihre Sozialformen massiv umformatiert; pastoraltheologisch geht es um die Frage nach Konzeption und Realität der kirchlichen basisnahen Organisationsformen in den letzten Jahrzehnten, und systematisch-theologisch schließlich um die normative Selbstdefinition von Kirche, wie sie im II. Vatikanum vorliegt, welche normative Selbstreflexion das für unser Thema einschlägige Verhältnis von Laien und Klerikern grundlegend neu entwirft.
Alle drei Fragestellungen sind von manifesten Dialektiken und Spannungen durchzogen. Sie können hier nur in thetischer verkürzung erörtert werden. Zumal abschließend gezeigt werden soll, dass diese drei analytischen Kontextualisierungen der Gemeindeleitungsproblematik sich in einer gewissen Weise zu einem neuen Horizont zusammenschließen, von dem zu hoffen ist, dass er eine weiterführende Perspektive eröffnet.
2 Die Gemeindeleitungsproblematik im Kontext neuer Formen religiöser Vergesellschaftung
Das Christentum hatte sich seit der Spätantike als spezifisches Machtgebilde aufgefasst und entworfen, hat die Relevanz der eigenen Botschaft in eindrucksvolle, machtdichte Sozialformen seiner selbst umgesetzt. Das Christentum hat mit der „Pastoralmacht“ 302, so Foucault, eine völlig neue Form religiöser Organisation und mit ihr eine ganz neue Machtform entwickelt.
Mit dem Auseinanderbrechen der mittelalterlichen „christianitas“ in der Reformation begann nach dem Konzil von Trient für die katholische Kirche schließlich jener neuzeitliche Weg, der für sie geradezu charakteristisch wurde und zu einer massiven reaktiven Verdichtung der sozialen Organisationsform kirchlicher Pastoralmacht führte: Die Schübe kirchlichen Reichweitenverlusts wurden seitdem durch Verdichtung der verbliebenen Sozialräume kompensiert, Exklusion und Integration also miteinander verschränkt. 303
Das Theorem der „societas perfecta“ formuliert dabei theologisch, was sich sozialgeschichtlich als der neuzeitliche Zwang zur „Organisation“ beschreiben lässt. Die Pianische Epoche der jüngeren katholischen Kirchengeschichte von Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts kann als Höhepunktphase dieser Form nun vor allem innerkirchlicher Pastoralmacht verstanden werden. 304Mit der allmählichen Liquidierung des „katholischen Milieus“ in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts und mit der Freigabe zur religiösen Selbstbestimmung auch für Katholiken und Katholikinnen, als mithin die schon länger wirksame strukturelle Säkularisierung der bürgerlichen Gesellschaften auch in die kulturelle Realität der Katholiken und Katholikinnen einwanderte, geriet nun aber die kirchliche Pastoralmacht in ihre aktuelle Krise.
Im gewissen Sinne findet gegenwärtig nichts weniger als die Verflüssigung der Kirche als eines sozialen Herrschaftssystems statt. 305Religiöse Praktiken werden im Zuge der globalen Durchsetzung eines liberalen, kapitalistischen Gesellschaftssystems in die Freiheit des Einzelnen gegeben 306und folgen damit im Übrigen nur vielen anderen, ehemals der Entscheidungsfreiheit des Individuums entzogenen Praktiken, etwa der Orts-, Berufs- oder Partnerwahl.
Auch in europäischen Gesellschaften mit starken, rechtlich wie finanziell privilegierten Kirchen und selbst für Katholikinnen und Katholiken gilt nun immer mehr, was etwa in der US-amerikanischen Gesellschaft auf Grund der ganz anderen religionspolitischen Vorgeschichte schon immer galt: Die Machtverhältnisse zwischen Individuum und den ehemals mächtigen Verwaltern der Religion haben sich umgedreht. Nicht mehr das Individuum richtet sein Leben nach den mehr oder weniger selbstverständlich übernommenen religiösen Vorgaben, sondern die aktuellen religiösen Praktiken werden nach den individuellen biografischen und existentiellen Bedürfnissen gewählt, und das stets ohne Rücksicht darauf, was die ehemals diskurs- und biografiedominierenden Instanzen der Religion als kohärent, notwendig und geltend erachten. Dieser Machtwechsel aber schreibt sich beiden, Individuen und Kirchen, unmittelbar ein.
Die katholische Kirche muss in unseren Breiten mit nichts weniger als dem Zusammenbruch ihrer altbewährten machtgestützten Formation zurechtkommen. Religiöse Praktiken werden unter ein individuelles Nutzenkalkül gestellt. Das gilt seit einiger Zeit auch für Katholiken und Katholikinnen. 307Ein „großer Teil des religiösen Pluralismus“, so Karl Gabriel, „spielt sich … unter dem Dach der großen Kirchen ab.“ 308
Das Nutzungsmuster von Kirche hat sich damit grundsätzlich gewandelt. Alle kirchlichen Handlungsorte geraten heute unter den permanenten Zustimmungsvorbehalt ihrer eigenen Mitglieder. 309Die Mehrheit der KatholikInnen nutzt die Kirche als „Kasualienfromme“ 310, fragt aktiv nur Ritualbegleitung an den Lebenswenden ab. 311Zudem wächst der Anteil jener, der nicht einmal dies mehr tut. Eine einschlägige Studie zum Themenfeld, der MDG-Trendmonitor 2010 „Religiöse Kommunikation“ 312, offenbart einmal mehr die mittlerweile breit dokumentierten Befunde einer grundsätzlichen Umstellung in der Kirchenbindungsstruktur und akzentuiert dies noch einmal generationenspezifisch, insofern er verdeutlicht, dass sich bei den jungen Kirchenmitgliedern keineswegs ein Gegentrend abzeichnet – im Gegenteil.
Wie nun zeigt sich der c. 571 § 2 in diesem Kontext? Im Lichte des epochalen Machtwechsels im Verhältnis von Individuum und religiösen Institutionen erscheint der c. 571 § 2 in einer merkwürdigen Doppelgestalt. Einerseits wirkt er als von diesem Machtwechsel scheinbar gänzlich unberührte, dekontextualisierte innerkirchliche Angelegenheit, die eine komplexe Ausnahmeregelung im Priester-Laien-Verhältnis vornimmt, dabei aber ein entscheidendes Merkmal religiöser Partizipation heute, ihre strikte Freiwilligkeit, außen vor lässt und im gewissen Sinne so tut, als ob die Standesherrschaft der Priester über die Laien noch selbstverständlich wäre, weswegen es Notlagen und manche theologischen Umwegargumentationen braucht, um sie an gemeindlichem Ort zumindest ein wenig zu relativieren.
Dass solch ein dekontextualisierter Diskurs möglich ist, der Laien, im Sinne des religiösen Marktes also die potentiellen Kunden, ganz selbstverständlich in eine untergeordnete Position gegenüber Priestern bringt, kann nun seinerseits wieder vieles bedeuten, etwa, und am naheliegendsten, dass die neue, kundenabhängige Lage der Kirche noch nicht wirklich in deren reflexives Bewusstsein gedrungen ist und sie sich immer noch im Zustand selbstverständlicher Herrschaft über ihre Mitglieder glaubt, einem Zustand, der bestenfalls gnädige Ausnahmeregelungen ihnen gegenüber erlaubt. Oder, wahrscheinlicher, dass die (gesetzgeberisch) Verantwortlichen der katholischen Kirche diese neue Lage zwar realisiert haben, der katholischen Kirche aber keine angemessenen Reaktionsmechanismen zur Verfügung stehen, darauf kreativ zu reagieren. Oder der c. 517 § 2 ist vielleicht die verschämte, also mehr oder weniger verschwiegene und versteckte Reaktion auf die neue kirchliche Lage.
Der dekontextualisierte Diskurs zum c. 517 § 2 macht aber auch auf eine spezifische Verschiebung im Rahmen dieses Machtwechsels aufmerksam: Zwischen Hauptamtlichen aller Art und den übrigen Mitgliedern der römisch-katholischen Kirche verläuft, anders noch als zu Zeiten des katholischen Milieus, heute eine höchst relevante Grenze. Hauptamtliche sind die letzten Laien, für welche die Freiwilligkeit und Offenheit religiöser Partizipation nicht gilt und klerikale Anweisungsmacht zumindest in erheblichen Resten noch besteht. Alleine die hauptamtlichen Laien sind unter einer gewissen priesterlichen Aufsichtsmacht verblieben. In diesem spezifischen innerkirchlichen Kontext und gegenüber Laien-Hauptamtlichen erscheint dann der c. 517 § 2, wiewohl er ja Laien einen gewissen Anteil an priesterlichen Statusrechten gibt, durch den Ausnahme- und Defizitcharakter, den er stets mitkommuniziert, als spezifischer Ausläufer eben jenes klerikalen Herrschaftsanspruchs.
Читать дальше