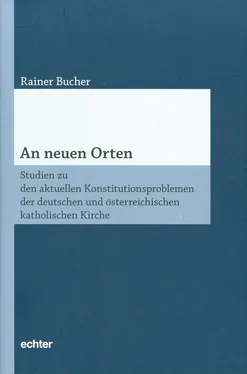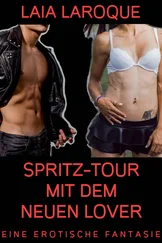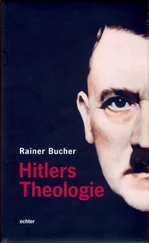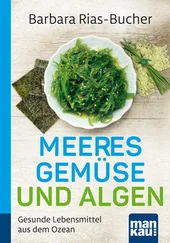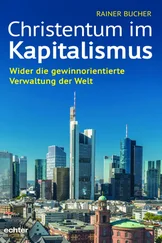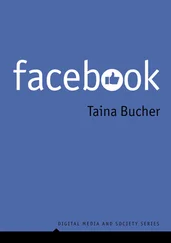Freilich, es gibt in diesem Zusammenhang noch einen ganz anderen, geradezu gegenteiligen Aspekt der neuen Lage der Kirche und er betrifft nun nicht das professionelle Innen, sondern eher das interessierte Außen. In postmodernen religiösen Kontexten und also auf dem religiösen Markt, der ja weniger dauerhafte Mitgliedschaft als situative, temporäre und intensitätsorientierte Partizipation kennt, besitzen profilierte, eigenwillige, sozusagen merk-würdige Angebote durchaus spezifische Marktchancen. Priesterliche Monopolismen, die den Priester gar sazerdotal im Gestus eines „heiligen, unberührbaren Mannes“ aufladen, entwickeln gerade in einer ansonsten strukturell säkularisierten und kirchlicher, ja religiöser Autorität entwöhnten Gesellschaft in gewissen, eng umschriebenen, aber nicht bedeutungslosen Kreisen durchaus eine gewisse Attraktivität. 313
In dieser Perspektive erscheint dann der c. 517 § 2, wie überhaupt schon die Anstellung und liturgische Aufgabenbetrauung von theologisch qualifizierten LaienmitarbeiterInnen, als Aufweichung der doch so eindrucksvoll unzeitgemäßen priesterlich-sazerdotalen, nicht ins Belieben des Volkes und damit jedermanns, sondern in die Heiligkeit eines ewigen göttlichen Willens gestellte Verfasstheit der katholischen Kirche.
3 Die Gemeindeleitungsproblematik im Kontext der professionellen Struktur der deutschen Kirche
Wie nun zeigen sich die Gemeindeleitungsproblematik und speziell der c. 517 § 2 im Kontext der klassisch pastoraltheologischen Frage nach Konzeptionen und Realität – beides ist bekanntlich alles andere als identisch – der kirchlichen basisnahen Organisationsformen in den letzten Jahrzehnten?
Das dominierende pastoralkonzeptionelle Modell für die Basisorganisation der katholischen Kirche der letzten Jahrzehnte war das Konzept der „lebendigen Gemeinde“. Die Ende des 19. Jahrhunderts zuerst im evangelischen Bereich entstehende Gemeindetheologie 314wollte intensive interne Kommunikation und Fürsorge sicherstellen. „Organisatorisch bedeutet dies eine Unterteilung der Gemeinde in immer kleinere Bezirke – denn zum einen sollte jedes Mitglied erfasst, gekannt und betreut werden“, zum anderen wollte man „eine auf persönlicher Kenntnis beruhende Gemeinschaft der Gemeindemitglieder untereinander.“ 315
Es hat gedauert, bis die quasi familiär verbundene Gemeinde zur Basis katholischen Organisationsdenkens wurde, letztlich geschah das erst Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Beispielhaft hierfür steht Ferdinand Klostermanns Parole „Unsere Pfarreien müssen zu Gemeinden werden“ 316aus der offiziösen Handreichung „Gemeinde“ für den pastoralen Dienst aus dem Jahre 1970. „Gemeinde“, das war hier konzipiert als Nachfolgestruktur der als anonym, bindungs- und entscheidungsschwach wahrgenommenen volkskirchlichen Pfarrstruktur. 317
Was real geschah, war freilich etwas ganz anderes. Zwar wurde die alte volkskirchliche und rein kirchenrechtlich definierte Territorialpfarrei mit gemeindetheologischen Kategorien aufgeladen, andererseits kam es ganz gegenläufig zu einem realen Funktionsverlust der Gemeinden im Zuge der pastoralen Professionalisierungs- und Ausdifferenzierungsprozesse der 1970er und 1980er Jahre.
Die Gemeindetheologie der 1960er Jahre zeigt sich als Versuch, in Zeiten der beginnenden Freisetzung zu religiöser Selbstbestimmung auch von Katholikinnen und Katholiken die katholische Kirche von einer amtszentrierten Heilsinstitution zu einer quasi-familiären Lebensgemeinschaft umzuformatieren. Durch Aufbau, Ausbau und theologische Unterfütterung einer spezifischen Sozialform von Kirche sollten die freiheitsbedingten Erosionsprozesse kirchlicher Konstitution gestoppt werden.
Das offenkundige Scheitern dieser Konzeption 318wird gegenwärtig vor allem im Zusammenhang mit der Bildung immer größerer pastoraler Räume diskutiert. Es stimmt ja tatsächlich: Alle aktuellen pastoralplanerischen Initiativen lösen das klassische „Normalbild“ einer um den Pfarrpriester gescharten, überschaubaren, lokal umschriebenen, kommunikativ verdichteten Glaubens- und Lebensgemeinschaft auf.
Unter den gegenwärtigen kirchenrechtlichen Bedingungen können die Pastoralämter gar nicht anders. Denn wenn man immer weniger zur Leitung privilegiertes Personal in einer hierarchischen Organisation hat, dann muss man es logischerweise auf einer höheren Organisationsebene ansiedeln. Wie man dann diese Ebene nennt, das ist demgegenüber relativ gleichgültig. Wichtiger scheint schon, wie man die Beziehung dieser ersten priesterlichen Ebene zur zunehmend entklerikalisierten und zudem zunehmend von professionell ausgebildeten pastoralen Laien dominierten Basis dann organisiert und konzipiert. In diesem Kontext wird ja dann auch der c. 517 § 2 relevant.
Für die Kirchenleitungen ergibt sich daraus jenes „Gemeindeleitungsdilemma“, entweder die Zulassungsbedingungen zum Priesteramt unverändert zu lassen, dann aber den Umbau der gewohnten priesterlichen Rolle zu akzeptieren, oder aber die Zulassungsbedingungen zum Weihepriestertum zu ändern, was zwar wohl ermöglichen würde, die gegenwärtige pastorale Struktur aufrechtzuerhalten, aber natürlich ein massiver Wandel in der bisherigen Tradition und vor allem der Selbst- und Fremdwahrnehmung der katholischen Kirche wäre, ein Wandel, der vor allem in seinen sozialpsychologischen Konsequenzen nicht zu unterschätzen wäre. Wofür sich die Kirchenleitung gegenwärtig entscheidet, trotz vieler Appelle, doch die Zulassungsbedingungen zum Weihepriestertum zu ändern, etwa von pastoraltheologischen 319und systematisch-theologischen Kollegen, 320Gemeindemitgliedern, 321Priestern 322und sogar Bischöfen, 323ist offenkundig.
Die Zulassungsbedingungen zum Weihepriestertum werden der katholischen Kirche ohne Zweifel noch viele Probleme bereiten, zumindest dann, wenn sie Wert darauf legt, weiterhin in den Gesellschaften des Westens inkulturiert zu bleiben. Die Gemeindetheologie wäre aber auch ohne die Verknappung der Priesterzahlen gescheitert, zuletzt vor allem an ihrem Charakter als halbierte, ja selbstwidersprüchliche Modernisierung und auch schon an ihrer systemwidrigen Verbindung mit der eigentlich volkskirchlichen und gerade nicht Partizipationsintensität voraussetzenden Territorialstruktur. 324
Die Gemeindetheologie steht in der neuzeitlichen Tradition katholischer Kirchenbildung: Sie denkt Kirche über eine spezifische Sozialform, also von ihrem institutionellen Pol her, nicht aber über pastorale Inhalte, also von ihrem Handlungs- und Aufgabenpol her. Dieser wird in ihr immer noch mit einer gewissen Selbstverständlichkeitsaura umgeben. Es hat gute Gründe, dass gerade zu den Hochzeiten der Gemeindetheologie die nicht-gemeindlichen, nicht-familiaristisch vergemeinschafteten Handlungssektoren der Kirche, also etwa Diakonie, Kategorialpastoral, so massiv ausgebaut wurden. Offenkundig war schon damals klar, dass der Slogan „Kirche ist Gemeinde“ schlicht nicht funktioniert und, würde man ihn konsequent realisieren, zu einer massiven Reichweitenbegrenzung kirchlichen Handelns führen würde. Wie stark diese im gemeindlichen Bereich ausfällt, das wurde spätestens seit der Sinus-Milieustudie und ihrem Befund der kirchlichen, genauer: gemeindlichen „Milieuverengung“ (Ebertz) 325deutlich.
In der Perspektive der bis vor kurzem gültigen gemeindetheologischen Ideale und im Rahmen des durch die Zulassungsbedingungen zum Weihepriestertum verursachten Gemeindeleitungsdilemmas erscheint der c. 517 § 2 nun aber als etwas verschämter Ausweg, die gemeindetheologischen Ideale aufrecht zu erhalten, ohne die Zulassungsbedingungen zum Weihepriestertum ändern zu müssen. In dieser Perspektive ist der c. 517 § 2, wie etwa Johannes Panhofer schreibt, „ ‚heilsamer Unsinn‘ “ als „Not- und Übergangslösung zu einer neuen Gestalt von Gemeinde“. 326Panhofer geht gar so weit, dem Kirchenrecht hier die „Rolle einer Geburtshelferin“ zuzugestehen, die es ermögliche, „in einem geregelten Rahmen etwas Neues (also Ungeregeltes) entstehen“ 327zu lassen.
Читать дальше