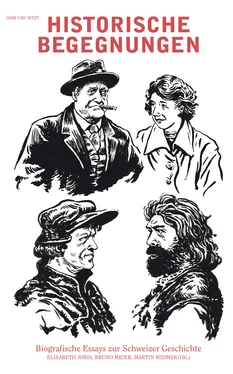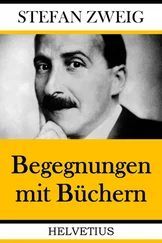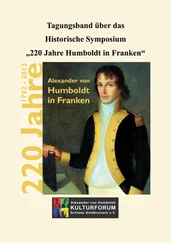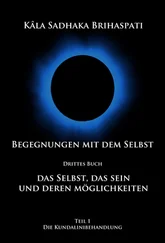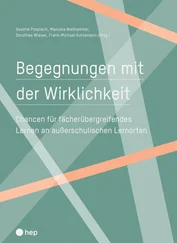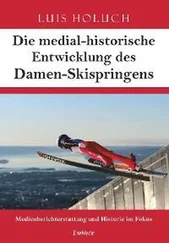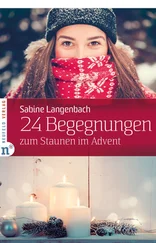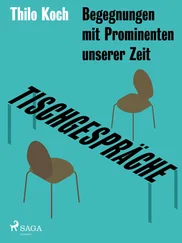Historische Begegnungen
Здесь есть возможность читать онлайн «Historische Begegnungen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Historische Begegnungen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Historische Begegnungen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Historische Begegnungen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Historische Begegnungen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Historische Begegnungen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Agnes wurde als Tochter von Albrecht von Habsburg wahrscheinlich im Sommer 1280 geboren. Ihr Geburtsort ist nicht verbürgt. Ihre Mutter Elisabeth von Görz-Tirol hielt sich zu dieser Zeit im Aargau auf, ein Geburtsort Brugg oder Baden ist also wahrscheinlich. Zwei Jahre zuvor, nach dem Sieg von König Rudolf von Habsburg über seinen Rivalen Ottokar von Böhmen, waren die Herzogtümer Österreich und Steiermark definitiv an das heilige römische Reich zurückgefallen. Rudolf versuchte, die beiden Herzogtümer seinen Söhnen zu verleihen, was ihm 1282 mit Zustimmung der königswählenden Fürsten auch gelang. Ab dieser Zeit wird Albrecht zusammen mit seiner rasch wachsenden Familie mehrheitlich in Wien residiert haben.
Johann von Viktring spricht der Agnes schon in Jugendjahren die Eigenschaften zu, die sie später auszeichnen werden: Sie sei fromm, freigebig gegenüber den Bedürftigen, wenig interessiert an der ritterlichen Kultur, aber gebildet und intelligent. Sie scheint von eher kleiner Körpergrösse und nicht besonderer Schönheit gewesen zu sein. Als junges Mädchen war sie Spielball der dynastischen Pläne der europäischen Fürstenhäuser. Angeblich zuerst einem Angehörigen der römischen Patrizierfamilie Colonna versprochen – die Habsburger versuchten sich eine römisch-cäsarische Verwandtschaft zuzulegen –, wurde sie im Jahr 1297 zum Friedenspfand in den Auseinandersetzungen zwischen Habsburg-Österreich und dem Königreich Ungarn. Sie wurde mit Andreas III. verheiratet, dem letzten Vertreter aus dem legendären Geschlecht der Arpaden auf dem ungarischen Königsthron. Andreas war ungefähr 15 Jahre älter als Agnes und verstarb bereits im Jahr 1301. Mit gut 20 Lebensjahren war Agnes also schon eine verwitwete Königin von Ungarn, gleichzeitig aber auch eine der besten Heiratspartien im europäischen Hochadel. Das berühmte, heute im Historischen Museum Bern ausgestellte Dyptichon von Königsfelden, wahrscheinlich eine venezianische Arbeit, ist ein Zeugnis ihrer wenigen Jahre in Ungarn. Andreas III. hatte dank seiner venezianischen Mutter als junger Mann eine Erziehung in Venedig genossen. Die Herkunft des Reisealtars wird damit in Zusammenhang gebracht.
Nach dem Tod von Andreas III. fanden sich Agnes und deren Stieftochter Elisabeth – eigene Kinder hatte sie nicht – gegenüber dem ungarischen Adel rasch in einer prekären Situation. Wahrscheinlich mit der Unterstützung einflussreicher ungarischer Adliger und unter Federführung von Hermann von Landenberg, einem engen Vertrauten und Marschall von Herzog Albrecht, gelang den beiden die Flucht aus der Burg Buda, Residenz der ungarischen Könige, nach Wien. Sie konnte dabei auch den legendären Schatz mitnehmen, von dem später oft gesprochen wurde und der ihren Reichtum begründet haben soll. Ihre offensichtliche Wohlhabenheit, die sich aus den zahlreichen Schenkungen an das Kloster Königsfelden ablesen lässt, gründet wahrscheinlich aber eher im Heiratsgut, der Herrschaft Pressburg, dem heutigen Bratislava, das sie noch weit über den Tod ihres Gatten hinaus nutzen konnte. Erst 1323 ging Pressburg definitiv an Ungarn zurück.
Es gibt keine Selbstzeugnisse der Agnes, aus denen hervorgeht, warum sie sich nicht wieder verheiraten liess, sondern ihr Leben als alleinstehende Witwe führte, zuerst an der Seite ihrer Mutter, später dann als «Mater familias» der Dynastie, als Förderin der Memoria an ihren Vater in Königsfelden und als politische Repräsentantin der Habsburger im Westen. Die Geschichtsschreiber haben dies ihrem frommen Wesen zugeschrieben. 1308, im Todesjahr ihres Vaters, war ihr ältester Bruder Rudolf bereits verstorben, ihre Brüder Friedrich und Leopold waren mit 19 und 18 Jahren knapp volljährig, das Schicksal der Dynastie im Reich völlig offen. War es eine innerfamiliäre Entscheidung, die ihre neue Rolle definierte, war es eine persönliche? Wir wissen es nicht. Es spricht vieles dafür, dass sie oder die Familie diesen Entscheid schon früher, nicht erst nach der Ermordung Albrechts, gefällt hatte. Ansonsten hätte sie wahrscheinlich schon kurz nach 1301 wieder auf dem europäischen Heiratsparkett eine Rolle gespielt.
Ihre neue Rolle als Hüterin der Erinnerung an ihren Vater und als Förderin des Klosters Königsfelden übernahm Agnes nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1313. Nach der Überführung des Leichnams von Elisabeth 1316 von Wien und dessen Beisetzung in Königsfelden setzte Agnes ihren Lebensmittelpunkt definitiv im Westen fest. Hier entfaltete sie ihre politische Bedeutung als Beraterin ihrer Brüder, als Schlichterin in den Konflikten im Raum zwischen Strassburg, Konstanz und Freiburg im Üechtland und vor allem als grosszügige Förderin des Klosters Königsfelden. In diesem Umfeld begegnete sie wohl spätestens 1336 auch Rudolf Brun, dem politischen Emporkömmling aus Zürich.
Alles ist offen: der Kampf um die Vorherrschaft zwischen Bodensee und Genfersee
Am 28. September 1343, ein knappes Jahr nach dem eingangs geschilderten Eheversprechen in Brugg, gipfelt die Versöhnung zwischen der Stadt Zürich, den 1336 verbannten Räten und dem Haus Habsburg beziehungsweise Habsburg-Laufenburg in einem weit gehenden Bündnis zwischen den mittlerweile mündigen Söhnen Johanns von Habsburg-Laufenburg – Johann II. und Gottfried – und der Stadt Zürich. Die Stadt Rapperswil wird in das Bündnis miteinbezogen. Rudolf Brun kann seinen Einfluss am oberen Zürichsee stärken und die Grafen von Rapperswil, die bei verschiedenen Zürcher Bürgern Schulden haben, stärker an die Stadt Zürich binden. Herzog Albrecht – seit Ende 1337 wieder ständig in Wien – scheint in dieses Bündnisprojekt nicht involviert zu sein. In der Folge schliessen weitere Verbannte Frieden mit der Stadt. Die Wunden sind aber nicht verheilt, wie die Konspiration zur Zürcher Mordnacht nur sechs Jahre später zeigen wird.
In welcher politischen Grosswetterlage stehen aber die Stadt Zürich und Habsburg-Österreich zueinander in diesen Jahren? Dazu noch einmal eine kurze Rückblende vor den Umsturz von 1336. Nach dem Tod des Gegenkönigs Friedrich von Habsburg im Januar 1330 begannen seine Brüder Otto und Albrecht mit König Ludwig dem Bayern eine definitive Beilegung des nun schon 15 Jahre dauernden Konflikts zu suchen. Bereits am 6. August 1330 kam es zum Vertrag von Hagenau, in dem der König den beiden Habsburgern für ihre Dienste die Reichsstädte Zürich, Schaffhausen, St. Gallen und Rheinfelden verpfändete. Das bedeutete für Zürich eine unmittelbare Bedrohung, die Gefahr, in den habsburgischen Machtbereich integriert zu werden und den Status als Reichsstadt längerfristig zu verlieren. Schaffhausen wird erst 1415 wieder den Ausstieg schaffen, Rheinfelden gar nicht mehr. Die Stadt Zürich konnte sich zwar wie St. Gallen innert kurzer Zeit aus der Verpfändung freikaufen, ein gutes Einvernehmen mit Habsburg-Österreich blieb aber wichtig. Die Herzöge Otto und Albrecht riefen 1333 einen allgemeinen Landfrieden aus, dem neben vielen anderen auch die Städte Bern und Zürich beitraten. Mit Baden, Winterthur, Regensberg, Zug und den Laufenburgern in Rapperswil hatte Habsburg-Österreich zahlreiche starke Positionen rund um Zürich inne.
Auch im Westen stehen die Zeichen für Habsburg-Österreich günstig. Nach dem Laupenkrieg zwischen Bern und dem burgundisch-kyburgischen Adel 1339 und der Anfang August 1340 in Königsfelden von Agnes von Ungarn angeleiteten Versöhnung begibt sich auch die Reichsstadt Bern Ende November 1341 in ein Bündnis mit Habsburg-Österreich. Schultheiss Johann II. von Bubenberg nutzt diese Situation, indem er sich die umstrittene Herrschaft Spiez definitiv als habsburgisches Lehen sichert. Ende 1347, nach dem Tod von König Ludwig dem Bayern, erneuern die Berner das Bündnis mit Habsburg. In den unsicheren Zeiten nach dem Tod eines Königs erscheint es den Bernern angebracht, sich mit der neben Savoyen im Südwesten wichtigsten Regionalmacht, eben den Habsburgern, die auch Herren der Nachbarstadt Freiburg sind, gut zu stellen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Historische Begegnungen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Historische Begegnungen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Historische Begegnungen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.