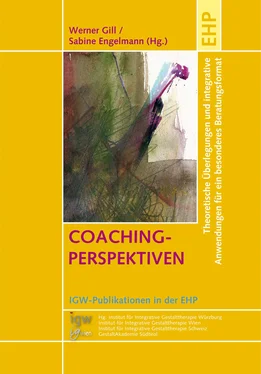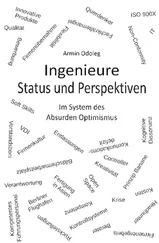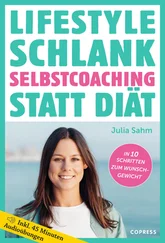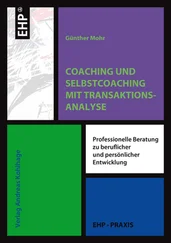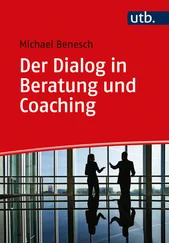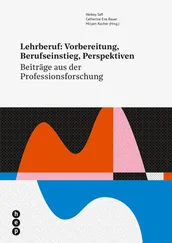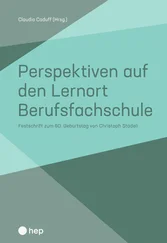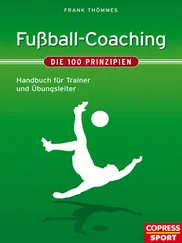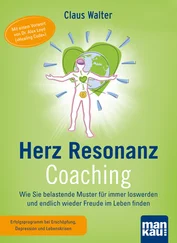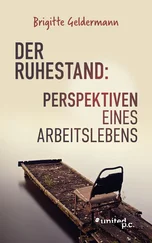Was zeichnet nun eine Organisation aus?
»Letztlich ist es die Kommunikation von Entscheidungen. Entscheidungen sind Ereignisse, durch die eine unsichere Situation soweit in Sicherheit umgewandelt wird, dass weitere Entscheidungen daran anknüpfen können. Organisationen befinden sich mithin in einem Dauerzustand der Unsicherheit über sich selbst und ihr Verhältnis zu ihrer Umwelt und nutzen diesen Zustand der Unruhe für ihre Selbstorganisation des Anknüpfens von Entscheidungen an Entscheidungen, die jeweils nur für eine ganz bestimmte Situation Unsicherheit absorbieren, um auf dieser Basis weitere Schritte der Unsicherheitsbewältigung aufsetzen zu lassen.« (Wimmer 2009, 24)
Aktuelle Geschehnisse/Ereignisse bewertet die Organisation retrospektiv als zielkongruent, nachträglich erhält das Ereignis einen Sinn verliehen, das geschieht weniger im Sinne einer Zielorientierung, ausgerichtet auf mögliche Zukünfte.
Das Verhältnis von Person und Organisation
Trotz der rückblickenden Zielinterpretation und der komplexen, widersprüchlichen Zielelandschaft, gelingt es Organisationen letztlich, die Handlungen aller Mitglieder fokussiert auszurichten. Der Mitarbeiter verzichtet dafür auf Teile seiner Autonomie, die Organisation hingegen auf eine vollständige Integration aller Elemente des Einzelnen.
Die zugrunde liegende Logik heißt: »Autonomie gegen Sicherheit«, für den einzelnen Mitarbeiter bedeutet dies, dass er Teile seiner Handlungsautonomie zugunsten übergeordneter, arbeitsteiliger Prozessmuster abgeben muss (Simon 2007a: 101 ff.).
Die resultierende Grundannahme der systemischen Organisationstheorie ist die Entscheidung, die Mitglieder einer Organisation zu deren Umwelt zu zählen. Das psychische System des einzelnen Mitarbeiters bleibt für das soziale System Organisation undurchschaubar, ist weder relevant noch nutzbar für die eigene Organisationslogik. Die selektive Nutzung einzelner Kompetenzen gehört zur Funktionsweise von Organisationen unter der Prämisse, das, was auch noch da ist, zu vernachlässigen. In das Zentrum rückt die Organisation nicht etwa Personen, sondern Funktionen, dies sichert die Austauschbarkeit ihrer Mitglieder und die Stabilität ihrer Prozesse, sprich Kommunikation ist unabhängig von Personen, obwohl sie natürlich die Träger der Kommunikation sind.
Führung sorgt dafür, dass die Organisation mit ihren Umwelten in einem beständigen Austausch und einer gesicherten Verbindung stehen. Das gilt für Kunden, Märkte ebenso wie für die Verbindung zwischen Mitarbeiter und Organisation. Führung geschieht damit an einer heiklen Schnittstelle von widersprüchlichen und paradoxen Erwartungen, die einen permanenten Ausgleich erfordert. Dieser Ort erfordert auch die permanente Versorgung des Systems mit Soll-Ist Differenzen, das Ausbleiben von irritierenden Herausforderungen ermöglicht der Organisation, sich auf sich selber zu konzentrieren.
Führung sorgt weiterhin dafür, dass die Komplexität und Widersprüchlichkeit der Organisation durch Entscheidungen reduziert wird und dadurch Folgehandlungen möglich werden. Entscheidungen werden immer im Zeichen von Ungewissheit getroffen, sind somit risikobehaftet, und der weitere Prozess ist unklar und schwer absehbar.
In Anlehnung an Rudolf Wimmer (Wimmer, 2009, 31 f.) ergeben sich die folgenden Aufgabenfelder:
• Das Aufgabenfeld »Zukunft«
Dieses Aufgabenfeld antwortet auf die Neigung der Organisation, sich in der Profilierung der eigenen Aktivitäten primär aus den Problemen der Vergangenheit zu versorgen. Führung »stört« die Vergangenheitsorientierung durch eine periodische Erneuerung des eigenen Existenzgrundes. Dies bedeutet, die Organisation konsequent von ihrer wünschenswerten Zukunft her führbar zu machen und sie bis zu einem gewissen Grad aus ihrer »Pfadabhängigkeit« zu befreien.
• Das Aufgabenfeld »Ausrichtung auf die relevanten Umwelten«:
Führung »stört« diese Neigung zur Binnenorientierung und zur eigenen Auslastung mit selbstbezüglichen Themen durch die Wiedereinführung des externen Blickwinkels auf relevante Umfeldentwicklungen und die damit verbundenen Herausforderungen des Marktes und anderer Umweltdimensionen.
• Das Aufgabenfeld »Umgang mit knappen Ressourcen«:
Im Blickfeld dieses Aufgabenfeldes steht die Auseinandersetzung mit dem Ressourceneinsatz. Organisationen neigen dazu, einen ständigen Mehrbedarf der für die anstehenden Aufgaben einzusetzenden Mittel zu generieren; sie besitzen eine eingebaute Tendenz zur »Verschwendung«. Führung »stört« durch ein gezieltes Ressourcenmanagement.
• Das Aufgabenfeld »Welche Art von Organisation?«:
Organisationen neigen dazu, an ihren einmal eingespielten Prozessen, Strukturen, Routinen und Regeln festzuhalten. Führung »stört« durch ein periodisches Auf-den-Prüfstand-Stellen der aktuellen Verfasstheit der Organisation.
• Das Aufgabenfeld »Kopplung von Person und Organisation«:
Bei diesem Aufgabenfeld geht es um eine Auseinandersetzung mit der aktuellen Personalsituation, d. h., es gilt Sorge zu tragen, dass die richtigen Leute an Bord sind, dass sie ihr Leistungspotenzial entfalten und dass sie sich mit den veränderten Anforderungen der Organisation mitentwickeln können.
1. Coaching richtet seine Aufmerksamkeit auf das jeweilige Ereignis und seinen relevanten Kontext: Wer ist dabei, welche soziale Regeln bestehen, was sind typische Muster, welche Deutungen beeinflussen Handlungen, …
2. Daraus folgt die Frage, was ist der entscheidende Ansatzpunkt für eine Veränderung: Personen, Strukturen, Prozesse, Regeln, …
3. Der Coachee entscheidet aufgrund seines Wissens über das System und die mögliche Angemessenheit der Ideen über die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten.
4. Persönliche Fragestellungen können Ausdruck einer strukturellen Problematik in der Organisation sein. Vorschnelles Zuschreiben auf individuelle psychologische Faktoren behindert den Coachee in seiner Autonomie gegenüber der Organisation und führt in Sackgassen.
5. Coaching ist Bestandteil des Interaktionssystems und nicht des Entscheidungssystems eines Systems: Im Coaching können keine Entscheidungen getroffen werden, noch kann die komplexe Dynamik vollständig abgebildet werden.
6. Die Gefahr bildet die Einladung zur Beliebigkeit der kommunizierten Beobachtungen und das gegenseitige Verlieren von Entscheidungsfähigkeit.
3. Coaching
»Könnte es vielleicht sein, dass ihre Couchmethode nichts anderes macht, als die Leute von ihren ausgelatschten, aber gemütlichen Wegen abzudrängeln, um sie auf einen völlig unbekannten Steinacker zu schicken, wo sie sich mühselig ihren Weg suchen müssen, von dem sie nicht die geringste Ahnung haben, wie er aussieht, wie weit er geht und ob er überhaupt zu einem Ziel führt?«
(Der junge Franz Huchel im Gespräch mit Sigmund Freud; aus: Robert Seethaler: Der Trafikant, 2014, 141)
Coaching wurde in den letzten Jahren ein zunehmend nachgefragtes Format der Unterstützung von Führungskräften in Organisationen. Oft genannte Bedingungen dafür sind einerseits die zunehmende Verdichtung der Arbeitswelt, stärkere Unübersichtlichkeit und gestiegene Leistungserwartungen, andererseits oft wenig ausgeprägte soziale Orte für die Reflexion der eigenen Tätigkeit.
Frei nach dem Motto »Lösung sucht nach Problem« entstand aus bewährten Vorgehensweisen im Bereich Unterricht und Sport ein Beratungsformat für das Management, schnell belegt aus dem englischen und amerikanischen Sprachraum mit einem eigenen Begriff: Coaching. Inzwischen besteht der Markt aus hoch differenzierten Coaching-Angeboten, die die Frage nach ihrer Wirksamkeit und Professionalisierung noch beantworten können.
Читать дальше