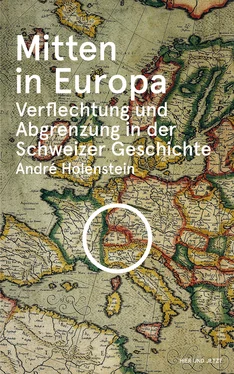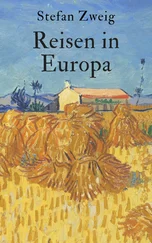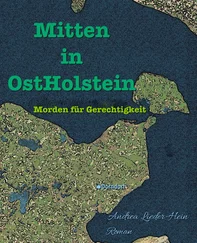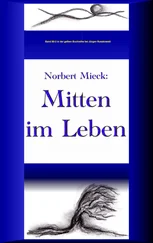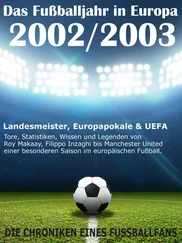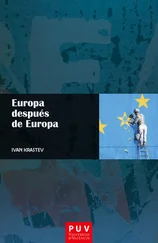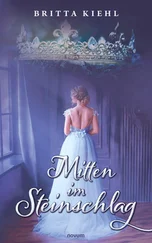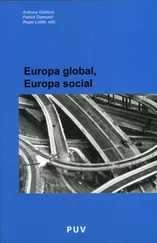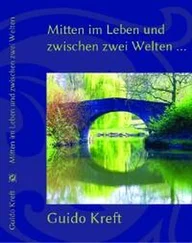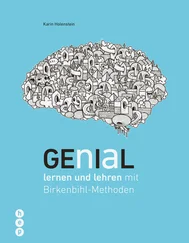André Holenstein - Mitten in Europa
Здесь есть возможность читать онлайн «André Holenstein - Mitten in Europa» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Mitten in Europa
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mitten in Europa: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Mitten in Europa»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Mitten in Europa — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Mitten in Europa», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Phase 2 (um 1520/50 bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts): Um die problematischen Folgen des ungeordneten Reislaufs in den Griff zu bekommen und die politische Kontrolle über dieses Geschäft durchzusetzen, ergriffen die eidgenössischen Obrigkeiten Massnahmen. Effizienter als die Verbote des unerlaubten Wegziehens in fremde Kriege waren diesbezüglich die Sold- und Allianzverträge mit den ausländischen Kriegsherren. Die Orte erkannten, dass sie den heimischen Söldnermarkt nur über Verträge mit den ausländischen Kriegsherren unter ihre Kontrolle bringen konnten. Wollten sie Kapital aus dem Soldgeschäft schlagen, mussten sie verhindern, dass die Kriegsherren auch ohne ihre Zustimmung zu Kriegern kamen. Langfristige Verträge zwischen Abnehmern und Anbietern regelten die politischen und finanziellen Rahmenbedingungen des Soldgeschäfts. Solche Allianzen und Kapitulationen bildeten seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts und bis zum Ende der fremden Dienste die Grundlage für das Soldgeschäft der eidgenössischen Orte. Die wichtigste und dauerhafteste Allianz war jene mit Frankreich, die 1521 erstmals geschlossen und 1777 ein letztes Mal vor der Entlassung der Schweizer Regimenter in Frankreich 1792 erneuert wurde.
Die Allianzen bestimmten die gemeinsamen sicherheitspolitischen Interessen, regelten die wechselseitigen Leistungen der Partner und definierten den Bündnisfall, der die Verbündeten zu militärischer Hilfe verpflichtete. Kapitulationen legten die Ernennung der Offiziere, die Termine der Musterungen und Soldzahlungen, die Höhe des Solds, die Dauer des Dienstes, die Gerichtsbarkeit über die Truppenangehörigen, deren Religionsausübung im Ausland und anderes mehr fest.
Mit der Kontrolle über das Soldgeschäft mit dem Ausland festigten die politischen Eliten in den Orten ihre Vorherrschaft im Innern. Die Ratsgremien in den Orten schlugen die Kandidaten für die Offiziersstellen vor und verteilten diese Posten zunehmend exklusiv an Angehörige von Ratsgeschlechtern. Der Offiziersdienst in einer Kompanie in fremden Diensten diente männlichen Angehörigen aus Ratsfamilien als Warteposition und Lehrzeit bis zur Wahl in den Rat und damit in ein einträgliches Amt zu Hause. Für die führenden Familien wurde das Militärunternehmertum – die operative Verantwortung für die Aufstellung, Ausbildung und Führung grösserer Verbände (Regiment, Kompanie) im Ausland – zu einer interessanten Tätigkeit, die neben der Aussicht auf Gewinn auch wertvolle soziale Kontakte verschaffte.
Die aufkommende Artillerie und die zunehmende Bedeutung langer Belagerungen von befestigten Plätzen veränderten den Charakter des Solddienstes. Die neue Kriegsführung erforderte die zunehmende Disziplinierung der Krieger im Rahmen einheitlicher, uniformierter Truppenverbände. Die Dienstzeiten waren nach wie vor befristet, dauerten nun aber deutlich länger als früher. Im Dreissigjährigen Krieg betrugen sie schon mehrere Jahre.
Die Schweizer Reformatoren verliehen der Kritik an der Reisläuferei eine Wendung ins grundsätzlich Religiös-Moralische. Die Interessengegensätze zwischen den traditionell stärker im Soldgeschäft engagierten Inneren Orten und den Städteorten waren eine Ursache für die Glaubensspaltung und führten zum Zweiten Kappeler Krieg 1531 zwischen den altgläubigen Orten der Innerschweiz und den reformierten Städten Zürich und Bern. Die reformierte Geistlichkeit blieb fortan der schärfste Kritiker der fremden Dienste, was mit ein Grund war, dass Bern und Zürich erst 1582 beziehungsweise 1614 der Allianz mit Frankreich beitraten.
Phase 3 (Mitte des 17. bis Mitte des 18. Jahrhunderts): Das 17. Jahrhundert und die beiden ersten Drittel des 18. Jahrhunderts sind in der Geschichte Europas eine Zeit fast ununterbrochener Kriege. Die Grossmächte begannen seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit dem Aufbau stehender Heere. Mit dem Wandel der Kriegstechnik wurden die Soldaten mit Gewehren mit aufpflanzbaren Bajonetten für den Nahkampf ausgerüstet. Die Taktik des Schlachthaufens mit Kurzwaffen und Langspiessen war definitiv überholt. Für die Schlacht wurden die Fusstruppen in kleinere Einheiten eingeteilt und auf lange Kampflinien ausgedünnt, damit diese dem Feuer der Artillerie möglichst wenig Angriffsfläche boten. Diese linienförmigen, lang gezogenen Verbände mussten im Gefecht auf Kommando mechanisch genaue Bewegungen ausführen, die in Friedenszeiten in der Garnison mit unablässigem Exerzieren und Drill eingeübt wurden. Die militärischen Einheiten wurden grösser, die Dienstdauer länger und genau festgelegt. Strengere Dienstreglemente betonten Rangordnung und Disziplin. Hatte die Beute lange einen Teil der Entlöhnung des Söldners abgegeben, so setzte sich das Verbot der Plünderung immer mehr durch.
Die Allianzen im Allgemeinen und das Soldgeschäft im Besonderen waren seit dem 17. Jahrhundert zunehmend mit strukturellen Problemen konfrontiert. Die exorbitanten Kosten für den Unterhalt der stehenden Heere und für die zahlreichen Kriege belasteten die Grossmächte. Immer häufiger blieben die jährlichen Pensionen an die Orte und deren politische Elite aus, oft erhielten Offiziere und Soldaten in den Schweizer Regimentern ihren Sold nicht oder nur verspätet. Bisweilen nahmen die ausländischen Kriegsherren selbst bei den Orten und bei Privatpersonen in der Eidgenossenschaft Kredite auf, um dringlichsten Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. In die Lücke sprangen in solchen Situationen seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auch Bankiers und Financiers, die in der Lage waren, kurzfristig grosse Summen Bargeld an die Truppen im Feld zu liefern und damit zu verhindern, dass die Verbände meuterten und kampfunfähig wurden. In der Kriegsfinanzierung betätigten sich auch Financiers aus Schweizer Handelsstädten, so etwa die St. Galler Familie Högger in Frankreich unter Ludwig XIV.
Die Kriegsherren intensivierten wegen der enorm steigenden Militärausgaben die bürokratische Kontrolle über ihre ausländischen Truppenverbände und schränkten die unternehmerische Freiheit der Soldunternehmer ein. Mit ausgabenseitiger Rationalisierung, das heisst durch die verschärfte Ausbeutung ihrer Soldaten, reagierten die Regiments- und Kompanieinhaber auf die sinkenden Gewinnmargen und auf steigende Werbekosten. Der Solddienst wurde auch für die Soldaten finanziell unattraktiver, weil die Handwerker- und Arbeiterlöhne in der Heimat nun vielfach höher lagen als der Sold. Die Militärunternehmer bekundeten zunehmend Mühe, die vertraglich vereinbarten Truppenbestände für die Kriegsherren zu rekrutieren, zumal die Zahl der Deserteure sehr hoch war. Zahlreiche Söldner nahmen Reissaus, sobald sie ihren ersten Sold, das sogenannte Handgeld, erhalten hatten, oder sie machten sich auf den Feldzügen davon. Es mehrten sich Zwangsrekrutierungen: Bettler und Landstreicher wurden verhaftet und in die fremden Dienste abgeschoben, junge Männer gerieten bei Trink- und Tanzgelagen in die Fänge professioneller Werbeagenten. Längst nicht mehr alle Soldaten in Schweizer Regimentern stammten im 18. Jahrhundert denn auch tatsächlich noch aus der Schweiz. In den bernischen Soldeinheiten stammte jeder Vierte nicht mehr aus dem Corpus helveticum. Der Anteil der Ausländer stieg jeweils dramatisch an, wenn es in den Krieg ging: Während des Siebenjährigen Kriegs stieg ihr Anteil im bernischen Regiment in Frankreich von 37 Prozent (1757) auf 56 Prozent (1763) an. 11Der hohe Ausländeranteil bereitete den Militärunternehmern Kopfzerbrechen, tolerierten doch die Kriegsherren in den Schweizer Einheiten höchstens ein Drittel Nichtschweizer. Die französische und die niederländische Militärverwaltung weigerten sich, Nichtschweizern den höheren Sold für Schweizer Soldaten zu zahlen. Gewiefte Militärunternehmer führten deswegen mitunter auch Lombarden als Tessiner Untertanen oder Schwaben als Thurgauer Untertanen in ihren Kompanielisten, weil diese Ausländer sich nur schwer von Eidgenossen unterscheiden liessen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Mitten in Europa»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Mitten in Europa» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Mitten in Europa» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.