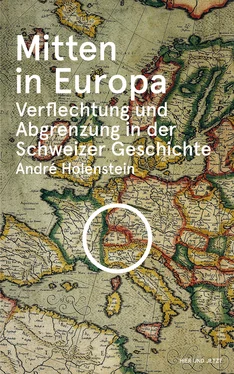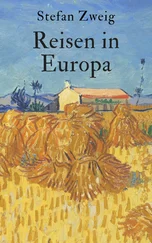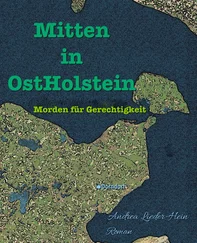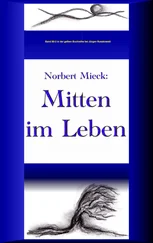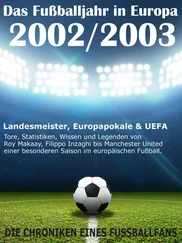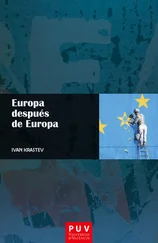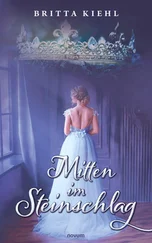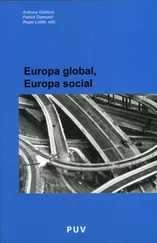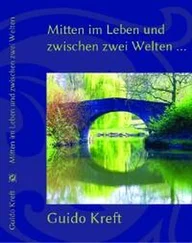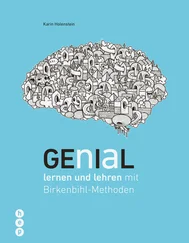André Holenstein - Mitten in Europa
Здесь есть возможность читать онлайн «André Holenstein - Mitten in Europa» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Mitten in Europa
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mitten in Europa: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Mitten in Europa»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Mitten in Europa — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Mitten in Europa», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Bald nach dieser Festigung des eidgenössischen Bündnisgeflechts wurde um 1470 erstmals die eidgenössische Gründungserzählung aufgezeichnet. Mit der heroischen Erzählung vom Widerstand der drei tapferen Länder am Vierwaldstättersee gegen die Willkür des Adels reagierten die Eidgenossen auf Vorwürfe Habsburg-Österreichs und der habsburgischen Kaiser, die die Eidgenossen als Zerstörer des Adels, als Rebellen gegen deren natürliche Herren und als meineidige, gottlose Feinde der ständisch-christlichen Gesellschaftsordnung brandmarkten. In ihrer Replik auf diese antieidgenössische Propaganda stellten sich die Eidgenossen als tugendhafte, gottesfürchtige, bescheidene Bauern dar («frume, edle puren»), deren sich Gott als Werkzeug bediente, um den tyrannischen, pflichtvergessenen Adel zu bestrafen. In ihren Schlachtensiegen über Habsburg und das Reich erblickten die Eidgenossen Urteile Gottes zugunsten eines auserwählten Volkes. Dieses moralisch höchst anspruchsvolle Eigenbild schrieb sich tief in das nationale Geschichtsbild ein. Die historische Forschung gab es erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts zaghaft auf, während es im Geschichtsbild der breiten Bevölkerung bis heute fortlebt. Die erstmals im sogenannten Weissen Buch von Sarnen (um 1470) fassbare eidgenössische Gründungserzählung zeugt von der sich festigenden Identitätsrepräsentation der Eidgenossenschaft. Die Zurückweisung der antieidgenössischen Propaganda ging Hand in Hand mit der Formulierung einer Identitätskonstruktion, die nichts weniger als die politische Eigenständigkeit rechtfertigte.
In jener Zeit, 1479, verfasste der Einsiedler Mönch Albrecht von Bonstetten (um 1442/43–1504/05) eine dem venezianischen Dogen, dem Papst und dem König von Frankreich gewidmete landeskundliche Beschreibung der Eidgenossenschaft. Diese früheste Beschreibung der Grenzen der Eidgenossenschaft situierte das Land topografisch im Herzen Europas und erklärte es zum «punctus divisionis Europe», zum Trenn- und Mittelpunkt des Kontinents. 6
Schliesslich klärte die Eidgenossenschaft im 15. Jahrhundert unter dem Einfluss der europäischen Mächtepolitik ihren Standort im Kreis der grossen Herren. Im Vorfeld der Burgunderkriege bereinigte sie mit der sogenannten Ewigen Richtung 1474 ihr Verhältnis zu Österreich-Habsburg. Die Habsburger verzichteten auf ihren früheren Herrschaftsbesitz im nunmehr eidgenössisch gewordenen Raum und sicherten sich dafür die militärische Unterstützung der Eidgenossen gegen Herzog Karl den Kühnen von Burgund (1433–1477, Herzog 1465–1477), ihren gemeinsamen Gegner. Die Schlachtensiege der antiburgundischen Allianz katapultierten die Eidgenossen auf die Bühne der Grossmachtpolitik und steigerten – angesichts der damals enorm wachsenden Nachfrage der Mächte nach Söldnern – schlagartig deren Attraktivität als Krieger und Bündnispartner.
In diese Zeit fiel auch die Klärung des Verhältnisses der Orte zum Reich. Kaiser und Reich waren im Spätmittelalter die entscheidende Legitimationsquelle für die wachsende Autonomie der Städte und Länder. Die Kaiser aus den Dynastien der Wittelsbacher und Luxemburger – beide Rivalen der Habsburger um die Kaiserwürde – bedachten die eidgenössischen Städte und Länder mit grosszügigen Privilegien. Sie stärkten damit deren Macht und politischen Gestaltungsspielraum. Das Reich war im 14. und 15. Jahrhundert aber nicht nur die entscheidende Quelle für die Legitimierung der Herrschaftsgewalt der Orte. Als Reichsoberhaupt lieferte König Sigismund (1368–1437, römisch-deutscher König seit 1411) den Eidgenossen 1415 mit der Verhängung der Reichsacht über Herzog Friedrich IV. von Österreich (1382–1439) auch die willkommene Rechtfertigung für die Eroberung des habsburgischen Aargaus und damit für die Möglichkeit, sich auf Kosten der Habsburger als Vormacht im Mittelland festzusetzen.
Die Eidgenossen waren dem Reich so sehr verbunden, dass sie am Ende des 15. Jahrhunderts sogar Krieg gegen dieses führten. Diese Feststellung ist weder unsinnig noch ironisch gemeint. An der Spitze des Reichs kam es am Ende des 15. Jahrhunderts zu Reformen und zur Schaffung neuer, zentraler Reichsinstitutionen. Als Reichsangehörige hätten auch die Eidgenossen die neuen Gremien anerkennen und mitfinanzieren müssen. Sie verweigerten jedoch ihre Beteiligung an der Weiterentwicklung der Reichsinstitutionen und hielten an ihrem traditionellen Reichsverständnis fest. Mit ihrem militärischen Sieg über König Maximilian I. (1459– 1519, römisch-deutscher König seit 1486) im Jahr 1499 klammerten sich die Eidgenossen zwar von der Reichsreform aus, ohne damit aber vom Reich unabhängig werden zu wollen. Vielmehr hielten sie bis ins 17. Jahrhundert, einige gar noch länger, an ihrem Bekenntnis zum Reich fest.
Im Hinblick auf eine Schweizer Geschichte in den Kategorien von Verflechtung und Abgrenzung bleibt festzuhalten, dass sich die eidgenössische Identitätsvorstellung im 15. Jahrhundert aus zwei Abgrenzungen speiste: zum einen aus der militärischen Behauptung gegen die herrschaftspolitische Konkurrenz von Habsburg und Burgund, zum anderen aus der propagandistisch-diskursiven Behauptung gegen die Stigmatisierung als gottlose Rebellen. Identitätsbildung und Alteritätserfahrung waren eng miteinander verschränkt.
Verflechtungen in der alten Schweiz
Die Betrachtung der vielfältigen Verflechtungszusammenhänge der alten Schweiz mit dem europäischen Umfeld setzt bei den Wanderungsbewegungen ein. Migration ist ein historisches Langzeitphänomen der Schweizer Geschichte. Menschen aus dem nachmals schweizerischen Raum waren auf Wanderschaft, lange bevor von einer Eidgenossenschaft die Rede sein konnte, geschweige denn bevor eidgenössische Diplomaten und Politiker formelle politische Beziehungen zu anderen Mächten knüpften. Ein nächstes Kapitel widmet sich den Warenströmen. Als rohstoffarmes Land war die Schweiz seit je existenziell auf die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern angewiesen. Ihre Ökonomie spezialisierte sich zudem frühzeitig auf die Veredelung von Rohstoffen, die von weit her eingeführt wurden, sowie auf die Herstellung von Exportwaren für internationale Märkte. Schon in der frühen Neuzeit vermarktete sie mit dem Käse, den Textilien, Uhren sowie Finanz- und Handelsdienstleistungen Güter und Dienstleistungen, die im Ausland das stereotype Bild der kommerziellen Schweiz prägen sollten. Schliesslich wird der Verflechtungsaspekt auch für den Bereich der Aussenpolitik, Diplomatie und der inneren Staatsbildung angesprochen werden. Spätestens mit den Burgunderkriegen in den 1470er-Jahren wurde die Eidgenossenschaft als geopolitisch exponierter Raum mitten im Spannungsfeld zwischen den rivalisierenden europäischen Grossmächten wahrgenommen. Als Übergangs- und Durchgangszone zwischen den Schauplätzen der grossen europäischen Kriege nördlich und südlich der Alpen wurde sie zum Tummelfeld der europäischen Diplomatie. Ihre Lage machte sie zu einem attraktiven Partner für Allianzen, aber auch zu einem sicherheitspolitischen Risiko für die grossen Nachbarn. Die Kantone mussten lernen, mit den Ansprüchen der konkurrierenden Mächte und den sich überkreuzenden Interessenlagen der grossen Nachbarn umzugehen. Wie für kein anderes Land in Europa gilt, dass nicht nur die innere Staatsbildung in den Kantonen in der frühen Neuzeit, sondern auch die schiere Existenz einer souveränen Nation Schweiz bis auf den heutigen Tag nur mit Rücksicht auf deren Verflechtung mit der europäischen Staatenwelt verständlich gemacht werden kann – die Eigenständigkeit der Schweiz gründet letztlich im Interesse Europas.
Verflechtung durch Migration
Migrationsbewegungen sind elementare Phänomene sozioökonomischer Verflechtung. Migranten verlassen die vertrauten sozialen und familialen Netzwerke ihrer Heimat für eine gewisse Zeit oder auf Dauer. Sie müssen sich in den Zielgebieten ihrer Wanderung orientieren, in einer neuen, sozial und kulturell fremden Umgebung bestehen und ein Auskommen finden.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Mitten in Europa»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Mitten in Europa» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Mitten in Europa» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.