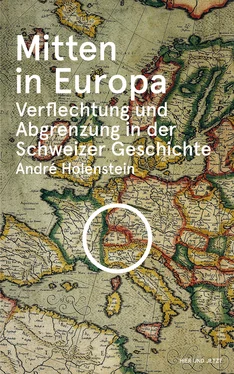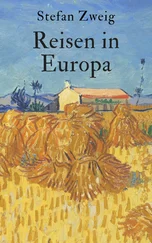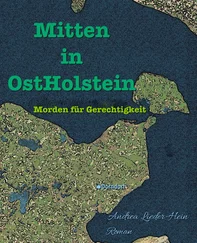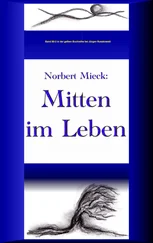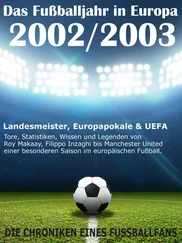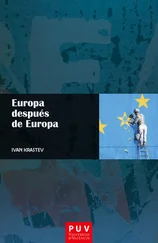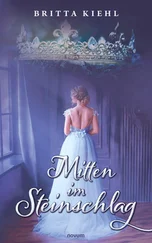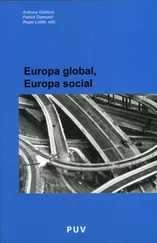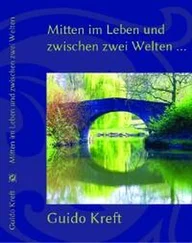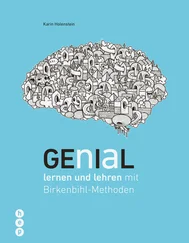André Holenstein - Mitten in Europa
Здесь есть возможность читать онлайн «André Holenstein - Mitten in Europa» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Mitten in Europa
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mitten in Europa: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Mitten in Europa»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Mitten in Europa — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Mitten in Europa», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Den drei nationalgeschichtlichen Erzählungen ist eines gemeinsam: Sie stellen die Geschichte des Föderalismus, der Souveränität und Neutralität der Schweiz als besondere Leistung und alleiniges Verdienst der Eidgenossen dar. Kriegerische Tapferkeit, höhere Einsicht, freiwillige Selbstbeschränkung, der Wille zur nationalen Einigkeit, die Fähigkeit zum Ausgleich und derlei politische Tugenden mehr hätten letztlich zum Erfolg schweizerischer Staatsbildung geführt.
Gegen diese einseitige, allzu selbstgefällige und vielfach schlicht falsche Sicht der Dinge nimmt diese Darstellung eine transnationale Perspektive ein. Sie fokussiert konsequent auf die Verflechtung des Landes mit dessen räumlichem Umfeld und bettet die eidgenössischen Kleinstaaten in grenzüberschreitende Kräftekonstellationen ein. Französische Historiker bezeichnen diesen transnationalen Ansatz als «histoire croisée», die anglo-amerikanischen Kollegen sprechen von «entangled history». Letztlich setzen diese Konzepte eine Binsenwahrheit der Handlungs- und Kommunikationstheorie um, wonach Individuen, Gruppen und grössere Gemeinschaften ihre Identität nicht autonom aus ihrer Selbstrepräsentation heraus entwickeln, sondern dies immer im Austausch mit sowie in Abgrenzung zu Anderen beziehungsweise Anderem tun. Dies gilt auch für Nationen und Staaten, die nicht als isolierte Einheiten existieren, sondern immer in Verflechtungszusammenhängen, die nicht statisch, sondern als dynamische Prozesse in Raum und Zeit zu denken sind.
Die Geschichte der Schweiz als die Geschichte ihrer Beziehungen zu Europa zu betrachten heisst, die isolierte Nabelschau aufzugeben. Die Verflechtungen des Landes und seiner Bewohner mit Europa und der Welt sind nicht als Beziehungen zu einem Äusseren und Fremden zu begreifen, sondern als entscheidender Faktor für die Gestaltung der Verhältnisse im Lande selber, die ohne deren Berücksichtigung unverständlich blieben.
Identitätsbildung und Alteritätserfahrung: die Gründung der Eidgenossenschaft im 15. Jahrhundert
Seit wann kann sinnvollerweise von einer Eidgenossenschaft mit Beziehungen zu einem weiteren Umfeld die Rede sein? Die Frage setzt die Existenz eines Gebildes voraus, das sich selber als etwas Eigenständiges betrachtete und auch von aussen als solches wahrgenommen wurde.
Die historische Forschung hat schon lange die Vorstellung von der Gründung der Eidgenossenschaft am 1. August 1291 oder auf dem Rütli am Jahreswechsel 1307/08 verabschiedet. 1291 schlossen drei Gemeinden in der Innerschweiz ein Landfriedensbündnis ab, ohne damit einen Staat machen zu wollen. Um 1470 wurde erstmals die heroische Gründungserzählung vom Rütlischwur und dem tapferen Freiheitskampf der Waldstätte gegen adelige Vögte aufgezeichnet, und knapp 100 Jahre später datierte der Glarner Gelehrte Aegidius Tschudi diese Geschehnisse erstmals auf den Jahreswechsel 1307/08. Nachdem der Schweizerische Bundesrat in den 1890er-Jahren den 1. August offiziell zum Nationalfeiertag erklärt hatte, verschmolzen die beiden ursprünglich eigenständigen Erzählungen im Geschichtsbild der breiten Bevölkerung zur irrigen Vorstellung, am Nationalfeiertag vom 1. August gedenke man jeweils des Rütlischwurs aus dem Jahr 1291.
Die entscheidenden Schritte zur Ausbildung einer unverwechselbaren eidgenössischen Identität erfolgten im 15. Jahrhundert. Im Begriff «Eidgenossenschaft» verdichten sich fundamentale Strukturmerkmale der politischen Organisation und Kultur der Schweiz, deren Wurzeln ins Spätmittelalter zurückreichen. Als politischer Akt impliziert der geschworene Zusammenschluss mehrerer zu einer Genossenschaft zweierlei: Der Eid stiftet zwischen eigenständigen Parteien einen neuartigen politischen Zusammenhang. Eine Föderation setzt voraus, dass sich die Parteien als politisch handlungsfähige Partner anerkennen, die ihre politischen Beziehungen autonom gestalten können. Bündnisse stiften Beziehungen zwischen Parteien, die für die Wahrung gemeinsamer Interessen näher zusammenrücken, dabei aber grundsätzlich ihre Eigenständigkeit bewahren wollen.
Nun gab es im Spätmittelalter in Europa nicht nur die eine (später Schweizerische) Eidgenossenschaft, vielmehr wimmelte es geradezu von Bündnissen. In einer Zeit starker machtpolitischer Konkurrenz, als die Machtinteressen unzähliger Herrschaftsträger zusammenstiessen, schien es Königen, Fürsten, Adeligen, Klöstern und Gemeinden ratsam, sich auf viele Seiten hin abzusichern. Bündnisse schufen politische und militärische Sicherheit. Zugleich setzten sie im Machtbereich der Bündnispartner den Landfrieden durch, das heisst sie stellten auf dem Weg vertraglicher Vereinbarung Rechtssicherheit und Gewaltfreiheit her in einer Zeit, die noch keinen Staat als Träger des legitimen Gewaltmonopols kannte.
Im nachmals schweizerischen Raum besass die bündische Bewegung ein starkes kommunales Fundament. Die sogenannten Länder – grössere ländliche Gerichtsgemeinden wie Uri oder Schwyz – waren im Spätmittelalter ebenso wie die Städte des Mittellandes im Wettlauf um Allianzpartner sehr aktiv. Mit ihren Bündnissen wollten die Städte und Länder im 13. und 14. Jahrhundert allerdings keinen Staat gründen. Erst die nationalpatriotische Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts hat aus der Vielzahl der Bündnisse der Städte und Länder im Spätmittelalter einige wenige ausgewählte zu eigentlichen schweizerischen Staatsgründungsakten stilisiert und die entsprechenden Urkunden zu sogenannten «Bundesbriefen» erhoben. Sie verkannte dabei die prinzipielle Offenheit der damaligen Macht- und Herrschaftslage und verkürzte in nationalgeschichtlicher Perspektive die komplexen Bündnisverhältnisse des Spätmittelalters zu einer Gründungsgeschichte, für die die sogenannten Eintritte der Kantone in den Bund die verfassunsgsgeschichtlichen Meilensteine auf dem langen Weg zum Bundesstaat des 19. Jahrhunderts bildeten.
Von welchem Zeitpunkt an verdichteten sich im schweizerischen Raum die offenen Herrschaftsverhältnisse, und warum entwickelte sich aus den Landfriedensbündnissen einiger Gemeinden die eine Eidgenossenschaft, die sich sowohl nach ihrem Selbstverständnis als auch in der Wahrnehmung von aussen als eigenständiger politischer Verband profilierte?
Die eigentliche Gründungszeit der Eidgenossenschaft ist das 15. Jahrhundert. Damals behaupteten sich die Kommunen – allen voran die Städte Bern, Zürich und Luzern – in der territorialpolitischen Konkurrenz gegen den Adel und insbesondere gegen Österreich-Habsburg als ihren schärfsten Rivalen. Nach dem Sieg der Waldstätte über ein österreichisches Heer bei Sempach 1386 führte die Eroberung des Aargaus – der alten habsburgischen Stammlande mit der namensgebenden Habsburg und den Klöstern Muri und Königsfelden als den beiden Hausklöstern und Grablegen der Habsburger – 1415 eine entscheidende Verdichtung eidgenössischer Herrschaft herbei. Die Eidgenossen teilten ihre gemeinsamen Eroberungen im Aargau – so wie später auch jene im Thurgau und im Tessin – nicht unter sich auf, sondern behielten sie als Untertanengebiete in kollektiver Verwaltung. Als «Gemeine Herrschaften» wurden sie fortan bis zum Ende des Ancien Régime reihum von Landvögten aus den beteiligten Kantonen verwaltet. Die hohe Bedeutung der Gemeinen Herrschaften für den Zusammenhalt der Eidgenossenschaft lässt sich daran ablesen, dass die gemeinsame Verwaltung auch nach der Glaubensspaltung fortgeführt wurde. Wie sehr die Verhältnisse unter den verbündeten Orten im 15. Jahrhundert ihre frühere Offenheit verloren und die Handlungsfreiheit der Gemeinden weniger wurde, musste die Stadt Zürich im sogenannten Alten Zürichkrieg (1436–1450) erfahren: Die übrigen Orte zwangen die Limmatstadt in einem blutigen Krieg dazu, ihr Bündnis mit Habsburg-Österreich aufzulösen und den Beziehungen zu den Eidgenossen den unbedingten Vorrang vor anderen Bündnissen einzuräumen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Mitten in Europa»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Mitten in Europa» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Mitten in Europa» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.