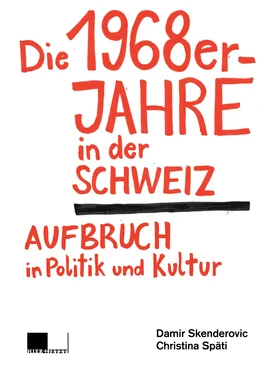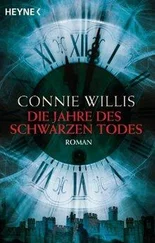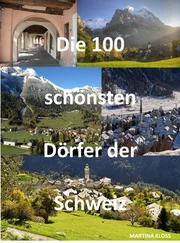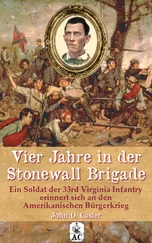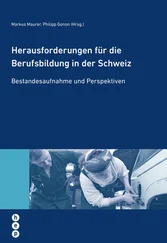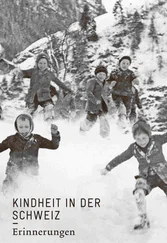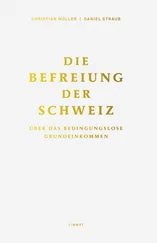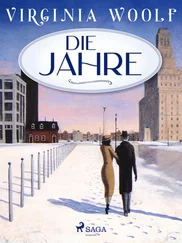Wenn heute von den «68ern» gesprochen wird, so umfasst dieser Begriff wenn nicht eine ganze Generation, so doch wesentliche Teile davon. Damals jedoch, Ende der 1960er-Jahre, sind es insgesamt gesehen nur wenige, vorwiegend junge Menschen, die zum Kern der 68er-Bewegung gehören und sich für Demonstrationen mobilisieren lassen, bei einer der diversen neu entstehenden Zeitschriften mitmachen oder sich kulturell engagieren. Und diese Akteurinnen und Akteure sind erst noch von ihrem sozialen Hintergrund, aber auch in ihren Zielen und Aktivitäten sehr heterogen. Während die einen aus bildungsbürgerlichem Hause kommen, an Universitäten studieren, stammen die anderen aus einfachen Verhältnissen oder haben einen Migrationshintergrund. Sind einige von marxistischen Schriften inspiriert und suchen ihr Betätigungsfeld vor allem in der Politik, engagieren sich andere in einer der subkulturellen Szenen oder interessieren sich für die sich allmählich entfaltende Gegenkultur, so etwa im Bereich Film, Musik oder Theater. Wichtig für das Verständnis der hier untersuchten Studierenden, Schülerinnen und Schüler, Kunstschaffenden, Intellektuellen, Lehrlingen, Arbeiterinnen und Arbeiter ist, dass sie an die Möglichkeit grundlegender Veränderungen der gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnisse glauben. Dabei geht es ihnen um eine Veränderung der Strukturen, nicht innerhalb von Strukturen unter Beibehaltung des Bestehenden. Entsprechend haben sie auch den Anspruch, eine «Revolution» oder zumindest eine Revolte durchzuführen.
Um verstehen zu können, warum es in den späten 1960er-Jahren zu einem globalen Ausbruch von Protesten kommen konnte, ist der Blick auf den damaligen sozioökonomischen und soziokulturellen Kontext und die Langzeitenwicklungen in Gesellschaft und Kultur zu werfen. Kapitel Izeigt zum einen, wie der wirtschaftliche Boom der Nachkriegszeit das Entstehen einer Konsumgesellschaft begünstigt, in der Jugendliche als zahlungskräftige Konsumentengruppe entdeckt werden. Die selbstbewusst gewordene Jugend entwickelt sich zur wichtigsten Trägergruppe einer kulturellen Aufbruchsstimmung, die sich zunächst vor allem in den Bereichen Musik, Literatur und Mode ausdrückt. Rock’n’Roll tritt seinen Siegeszug durch die globale Musikwelt an, und mit den Halbstarken, aber auch den Beatniks und Situationisten entstehen subkulturelle Szenen, die ihren Unmut oder ihre Gegnerschaft zum herrschenden Konformismus öffentlich ausdrücken. Zum anderen wird im Kapitel Iein zeitgeschichtliches Panorama der Schweiz der 1950er- und frühen 1960er-Jahren gezeichnet. Auch sie profitiert vom Wirtschaftsboom, der zum Ausbau der Infrastruktur sowie zum Anstieg des Wohlstands und Massenkonsums führt und von sozialer und politischer Stabilität begleitet ist. Antikommunismus und eine Wiederbelebung des Überfremdungsdiskurses bestimmen die politischen Debatten, wobei sich ab Mitte der 1960er-Jahre auch kritische Stimmen zu regen beginnen. Nicht nur an den Universitäten, sondern auch in der Friedensbewegung, den sogenannten Nonkonformisten und den aufkommenden subkulturellen Szenen lassen sich Vorläuferbewegungen von «1968» erkennen.
In den Jahren 1968, 1969 und 1970 kommt es dann wie in vielen Ländern auch in der Schweiz zu einem Anstieg der Protestereignisse, und es findet an zahlreichen Orten eine breite Palette an Aktivitäten und Mobilisierungen statt. Kapitel IIvermittelt einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen in diesen Jahren in den USA und in Europa. Daran anschliessend folgt eine Übersicht über die Ereignisse in der Schweiz. Während es im Jahr 1968 selber in der französischen Schweiz und im Tessin an den Universitäten und Mittelschulen brodelt, ist es in der Deutschschweiz vor allem die Strasse, auf die der Protest getragen wird. Die Behörden sind durch die Ereignisse im Ausland, vorab in Frankreich, aufgeschreckt, was sich in ihren Reaktionen auf die 68er-Bewegung niederschlägt. An den Universitäten begegnen die Universitätsleitungen den Forderungen der Studierenden nach mehr Mitspracherecht mit einem gewissen Verständnis und Gesprächsangeboten. Auf der Strasse hingegen wird hart durchgegriffen. Wiederholt kommt es in diesen Monaten zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei, wobei der in die Annalen eingegangene Globuskrawall nur die Spitze des Eisbergs darstellt. Auch in den subkulturellen Szenen vermehren sich die Aktivitäten, und die Zahl der Anhänger und Interessierten nimmt zu, sodass zusehends eine breite, facettenreiche Gegenkultur der Musik, Literatur, Kunst und des Theaters entsteht.
Im Kapitel IIIliegt der Schwerpunkt auf den Forderungen, Aktionsmitteln und Strategien der 68er-Bewegung. Wie in anderen Ländern auch zielt in der Schweiz eine wichtige Forderung der Bewegung auf die Beendigung des Vietnamkriegs ab. Allgemein spielen für grosse Teile der Bewegung internationale Solidarität und eine scharfe Kritik am sogenannten US-amerikanischen Imperialismus eine wichtige Rolle. Ebenso kritisieren viele der Beteiligten den diskriminierenden Umgang mit den Arbeitsmigrantinnen und -migranten und die wiederbelebten Diskussionen um die «Überfremdung». Andere Forderungen zielen, wie etwa an den Universitäten, auf Demokratisierung und Mitspracherechte ab, während sich im Engagement für Jugendzentren der Wille zu mehr Selbstbestimmung und Autonomie ausdrückt. Mit Demonstrationen, Strassentheatern, Sit-ins, Go-ins und Teach-ins, aber auch mit der Gründung von neuen Zeitschriften und übergreifenden Netzwerken versucht die Bewegung, ihren Forderungen Ausdruck zu verleihen. Auch in den neuen Lebensformen und Lebensstilen, im Drogenkonsum, in der Befreiung von sexuellen Zwängen, im ekstatischen Tanzen zu psychedelischen Klängen oder im Zusammenleben in Kommunen zeigt sich der Wunsch nach einem Ausbruch aus dem gesellschaftlichen Konformismus.
Ihren Höhepunkt erreicht die Bewegung in der Schweiz in den Jahren 1968 und 1969, danach beginnt die breite Koalition von unterschiedlichsten Akteurinnen und Akteuren zu bröckeln, die sich im Zeichen der Hoffnung auf eine wirkliche Veränderung der Gesellschaft zusammengetan haben. Kapitel IVbefasst sich mit diesem Zerfallsprozess, sowohl international wie in der Schweiz. Es zeigt die unterschiedlichen Wege auf, die die «68er» zu Beginn der 1970er-Jahre eingeschlagen, und die Strategien, die sie gewählt haben, um ihre Ziele doch noch erreichen zu können. An den Universitäten radikalisiert sich der Protest Anfang der 1970er-Jahre, und die noch kurz zuvor demonstrativ zur Schau gestellte Diskussionsbereitschaft der Behörden weicht einer zunehmenden Repression. In der französischen Schweiz setzen sich die Proteste auf den Strassen fort, wobei nun vor allem die erstarkte Gegenkultur zum Motor der Mobilisierungen wird. Inzwischen beginnen sich die von der 1968er-Bewegung entworfenen alltagskulturellen Praktiken in der ganzen Schweiz auszubreiten, und aus der Gegenkultur heraus entstehen zahlreiche Projekte wie genossenschaftliche Betriebe, Kultureinrichtungen, antiautoritäre Kindergärten, alternative Presseerzeugnisse und so weiter. Mit dem Engagement in den aufkommenden neuen sozialen Bewegungen wie der Umwelt-, Frauen- oder Friedensbewegung zu Beginn der 1970er-Jahre verabschieden sich viele «68er» vom revolutionären Selbstverständnis und mässigen ihre Forderungen. Mit dem Einsetzen der Wirtschaftskrise Mitte der 1970er-Jahre schwindet der reformbereite Elan, der die «68er-Jahre» fast ein Jahrzehnt lang geprägt hat.
Was bleibt von der 68er-Bewegung? Was hat sie bewirkt, wie ist sie zu interpretieren, und wer fühlt sich überhaupt dazugehörig? Diesen Fragen der Wirkungs- und Zurechnungsgeschichte, der Suche nach den Gründen für die Mythen zu «1968» geht das Kapitel Vnach. Es zeigt auf, wie uneinig sich auch mehr als 40 Jahre danach Historikerinnen und Historiker, aber auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen darüber sind, was «1968» denn wirklich bedeutet habe. Als Chiffre steht «1968» für vieles und kann vor allem nicht auf die Ereignisse um das Jahr 1968 reduziert werden, deshalb auch die Anführungszeichen. Längst ist «1968» mythologisiert worden, ein jeder interpretiert es nach seinem Gutdünken, und oft sind Deutungen mehr von tagespolitischen Interessen geleitet als von historischen Erkenntnissen. Mit der historischen Rekonstruktion der damaligen Ereignisse sowie anhand geschichtswissenschaftlicher Interpretationen soll das vorliegende Buch einen Beitrag zur Historisierung von «1968» leisten, die in der Schweiz über 40 Jahre danach noch in ihren Anfängen steckt.
Читать дальше