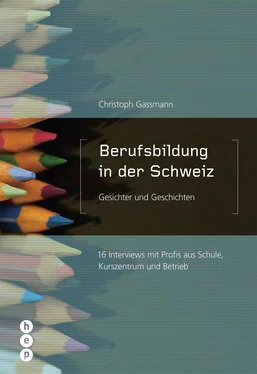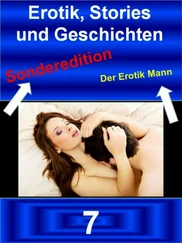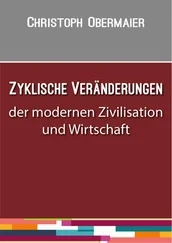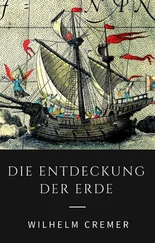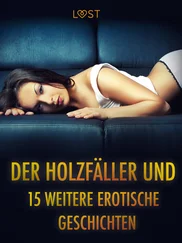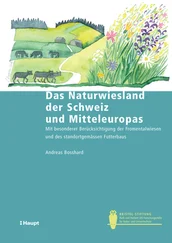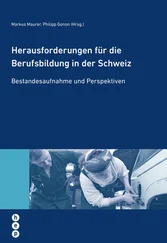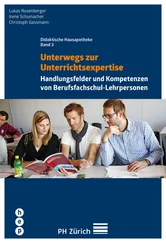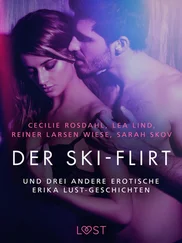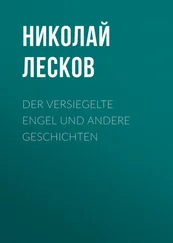Zwar ist der Böllerlärm inzwischen verstummt, die Berufsbildung wird wieder etwas in den Hintergrund rücken. Aber sie wird weiter Thema bleiben, nicht zuletzt, weil in einigen Branchen, darunter wichtigen, auch zukunftsmächtigen Wirtschaftszweigen wie Technik, Informatik, Pflege, in naher Zukunft ein Fachkräftemangel droht – oder schon Tatsache ist. Nach Jahren der Lehrstellenknappheit können nicht mehr alle Lehrstellen mit geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten besetzt werden. Vor allem die leistungsstarken Jugendlichen kommen den Betrieben zunehmend abhanden, in der Tat entscheiden sich viele heute für den gymnasialen Weg.
So stehen Bildungspolitik und -forschung vor neuen Herausforderungen: Welche Reformen sind unabdingbar, damit das schweizerische Berufsbildungssystem auch die Aufgaben der Zukunft meistern kann? Wie lassen sich zum Beispiel die Übergänge zwischen obligatorischer Schule und Berufsbildung, wie liesse sich der Einstieg in die Arbeitswelt noch besser gestalten? Welche Möglichkeiten gibt es für Erwachsene, die ohne Sekundarstufe-II-Abschluss im Arbeitsleben stehen, eine solche Qualifikation nachträglich zu erwerben? Das Thema ist auch aus sozialpolitischer Perspektive von einiger Brisanz: Fehlende Bildung ist nachweislich ein Armutsrisiko, vor allem vor dem Hintergrund steigender Anforderungen in der Arbeitswelt.
In all den Debatten – und soweit ich sehe, auch in der Forschung – kommt eine Seite bisher kaum angemessen zu Wort – neben den Auszubildenden die eigentlichen Helden des Berufsbildungsalltags, die das System tragen und prägen: die Lehrpersonen und Ausbildner/innen an allen drei Lernorten.
Insofern betritt diese Publikation nahezu unbekanntes Territorium: Sechzehn Berufsbildungsprofis geben im persönlichen Gespräch Auskunft über ihren Werdegang, ihren Ausbildungsalltag, ihre Ziele, Positionen, Visionen und Träume.
Das erste Gespräch, das mit Mine Dal, fand im Dezember 2010 statt, das letzte, mit Sandra Jungo, im Februar 2014. Die Gespräche dauerten zwischen anderthalb und dreieinhalb Stunden; die Abschriften durchliefen einen Prozess mehrfacher Verdichtung und «Rekomposition». Einzelne Interviewpartnerinnen und -partner kenne ich seit Jahren, was das vertraute Du erklärt, andere habe ich auf Anregung von Kolleginnen und Kollegen extra für dieses Projekt kontaktiert.
Ziel war von Anfang an eine möglichst bunte Mischung: Berufsfachschullehrpersonen, haupt- und nebenamtliche betriebliche Ausbildnerinnen und Ausbildner aus verschiedenen Berufen und Branchen und unterschiedlichen Alters, üK-Leiterinnen und -Leiter; Menschen mit einer etwas ungewöhnlichen Geschichte oder einem speziellen Hintergrund, einem ungewöhnlichen Zugang, Affinität zu Jugendfragen und zur Berufsbildung, kritischem Blick, Begeisterung und Lebenserfahrung. Männer und Frauen. Schweizerinnen und Schweizer, Ausländerinnen und Ausländer.
Ausgangspunkt war jeweils derselbe lockere Fragenkatalog, aber die Gespräche sollten jederzeit offen bleiben, sollten abschweifen dürfen. Die Interviewpartnerinnen und -partner sollen ihre eigenen Akzente setzen können. Uniformität war nicht angestrebt, weder der Form noch der Inhalte. Auch Queres, Abweichendes, auch Scheitern sollte seinen Platz haben – im Zentrum stand immer die Persönlichkeit der interviewten Person.
Vier Jahre sind eine lange Zeit, in der sich vieles verändern kann. Zum grössten Teil waren die Gespräche aber kaum an der unmittelbaren Aktualität ausgerichtet, die Protokolle liefern so zwar nur Momentaufnahmen, die aber über den Augenblick des Gesprächs hinaus Aussagekraft behalten. Das hat auch die Überprüfung gezeigt: Mit fast allen Interviewten habe ich mich im Sommer 2014 noch einmal getroffen, alle haben die Protokolle aus der Distanz noch einmal gelesen, kommentiert und berichtigt, zum kleinen Teil ergänzt. Bei den Nachfolgetreffen sind auch die meisten Bilder entstanden.
Die Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner war zwar nicht willkürlich, aber auch nicht repräsentativ. Wichtige Branchen fehlen, die Banken zum Beispiel oder die Tourismusindustrie. Das Bauhauptgewerbe ist nur am Rande Thema. Die Metallindustrie hingegen ist deutlich übervertreten, was sich insofern gut trifft, als in den Berufen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie die Nachwuchsprobleme heute besonders ausgeprägt sind.
Vertreten sind aber alle drei Lernorte: die Betriebe, vom Kleingewerbe bis zum internationalen Konzern; der schulische Bereich, von der Berufsfachschule bis zur Fachhochschule; aber auch der «dritte Lernort», die Ausbildungs- und Kurszentren. Das Spektrum der Berufe, die zur Sprache kommen, reicht vom Kaufmännischen und Verkauf über das Baugewerbe, die Berufe der Maschinen-, Elektronik- und Metallindustrie und der Pharmabranche bis zur Pflegefachperson und zur Hebamme. Trotz mangelnder Repräsentativität ergibt sich so vielleicht doch ein guter Querschnitt durch die Welt der schweizerischen Berufsbildung. Auch die eingeschränkte Auswahl liess zu, dass wichtige Fragen des schweizerischen Berufsbildungssystems im Gespräch zumindest gestreift wurden.
Ohnehin ist das System ja viel komplexer, als die Rede von der dualen Berufsbildung unterstellt. Er habe viele Jahre gebraucht, um sich in dieser Welt einigermassen orientieren zu können, meinte Emil Wettstein, einer der Doyens der schweizerischen Berufsbildung, bei seiner Verabschiedung als Dozent an der Universität Zürich vor einigen Jahren. Und dass das System so komplex ist, leuchtet unmittelbar ein: Auch die Arbeitswelt ist schliesslich komplex: Es gibt zum Beispiel rund 230 vom Bund anerkannte Lehrberufe – von Agrarpraktiker/in EBA bis Zweiradmechaniker/in EFZ der Fachrichtungen Fahrräder oder Kleinmotorräder. Und die betriebliche Grundbildung, die «Betriebslehre» ist bekanntlich nur eine Form von beruflicher Bildung, es gibt eine lange Reihe anderer Formen: Lehrwerkstätten, Lehren mit Basisjahr, mit degressivem Schulanteil, von der «höheren Berufsbildung», der «akademischen Berufsbildung» zu schweigen.
Mehr als punktuelle Einblicke in dieses komplexe System sind aus Gesprächsprotokollen nicht zu erwarten. Wer sich genauer informieren will, sei hier deshalb auf die systematische Literatur verwiesen, etwa auf die hep-Publikation von Emil Wettstein, Evi Schmid und Philipp Gonon («Berufsbildung in der Schweiz») oder auf die Bücher von Rudolf Strahm.
Einige Begriffe und Kürzel werden aber in einem Glossar im Anhang erklärt, soweit es für ein Verständnis bestimmter Passagen in den Gesprächen nützlich schien. Dort finden sich auch ein paar weitere Literaturhinweise.
Ohne Hilfe und Unterstützung hätte ich diese Publikation niemals zu Ende gebracht. Besonderer Dank gebührt:
-Andreas Schubiger und Christoph Städeli fürs Knüpfen von Erstkontakten;
-der PH Zürich, namentlich Claudio Caduff, Markus Maurer und Christoph Städeli für Ermunterung, sanften Druck, Feedback auf eine frühere Fassung der Texte und zahlreiche Anregungen;
-Brigitt Thambiah und Sunanda Mathis für die Hilfe beim Erfassen der Gesprächsprotokolle;
-Susanne Gentsch vom hep verlag und Ilka Mathis dafür, dass sie ihren Finger auf wunde Punkte und heikle Stellen gelegt haben;
-Laura Dal Ben und Christoph Settele von pooldesign und dem hep-Team für die sorgfältige Gestaltung;
-aber vor allem meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern für die Zeit, die sie für dieses Projekt geopfert haben, und ihre unendliche Geduld.
Christoph Gassmann
März 2015
Berufsbildungsgetränkt – Andreas Grassi

Berufsbildungsgetränkt
Читать дальше