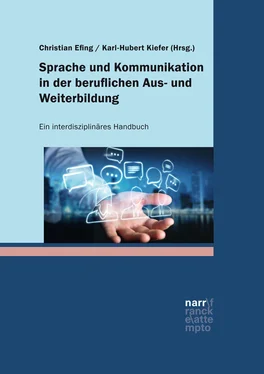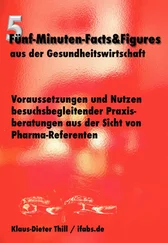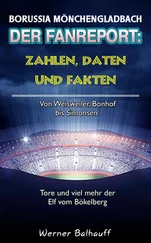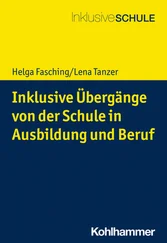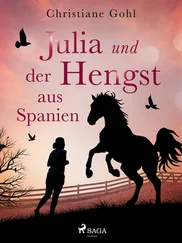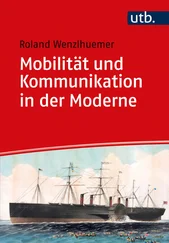(1) Lernen ist Aneignung. Dieses ‚lebt‘ von den Umgangserfahrungen des Subjekts mit sich selbst und seiner Selbstwirksamkeit, seiner Stellung in sozialen Systemen und mit überlieferten bzw. übergebenen Wissensbeständen.→ Eine Kompetenzdidaktik muss deshalb „gezielt günstige Gelegenheiten für ein solches reflexives Lernen schaffen.“
(2) Das Eigene ist mächtig, es kann nicht übersehen oder dementiert werden. Es ist in erster Linie emotionale Identität, d.h. die Summe der biografisch zu Mustern des Wollens und Könnens geronnenen Selbstwirksamkeitsgefühle des reifenden Subjekts.→ Diese emotionale Identität bestimmt bereits den Bereich der Wissensaufnahme und -vermittlung. Eine methodisch-didaktische Konsequenz besteht daher in der besonderen Aufmerksamkeit für Werte, Haltungen, Emotion, Motivation und den damit verbundenen methodisch-didaktischen Umgehensweisen wie emotionale Labilisierung, Wertinteriorisation.
(3) Kompetenzentwicklung gelingt nur in Eigenregie des lernenden Subjekts. Dieses muss die Ziele, um die es geht, möglichst früh und möglichst präzise kennenlernen – in einer Weise, die es ihm ermöglicht, kontinuierlich den eigenen Prozess zu überprüfen und immer wieder neu zu justieren.→ Dazu verhilft, wie z.B. im Konzept der Lernprozessbegleitung veranlagt, eine dialogische Beziehungsstruktur zwischen Lehrenden und Lernenden.
(4) Lehren ist eine Inszenierung von Erfahrungsräumen, in denen den Lernenden Erklärungs-, Vertiefungs- und Diskursmöglichkeiten eröffnet werden, die sie zu ihren Bedingungen nutzen können, ohne dass diese unmittelbar auf die Lernenden einwirken oder ihre Kompetenzentwicklung ohne deren innere Zustimmung nachhaltig beeinflussen können.→ Eine Konsequenz besteht in der Orientierung an einer „Ermöglichungsdidaktik“ (vgl. z.B. Arnold 2012).
Was besagt das alles hinsichtlich unserer anfänglichen Frage nach der Entwicklung sprachlicher bzw. sozial-kommunikativer Kompetenzen?
2.2 Anwendung auf die Entwicklung von Sprache und Kommunikation – Beispiele
Die Wandlungsbedingungen in der Arbeits- und Berufswelt lassen keinen Zweifel daran, dass das Subjekt zunehmend auf sich, seine Handlungserfahrungen und inneren Orientierungen angewiesen ist und eine sozial-kommunikative Kompetenz eine Handlungsanforderung darstellt, die durchgängig an Bedeutung gewinnt. Ihre Benennung als sozial und kommunikativ beschreibt die real wachsende Verflechtung dieser Anforderungen: „kommunikativ und kooperativ selbstorganisiert zu handeln, d.h. sich mit anderen kreativ auseinander- und zusammenzusetzen, sich gruppen- und beziehungsorientiert zu verhalten, und neue Pläne, Aufgaben und Ziele zu entwickeln“ (Erpenbeck & Rosenstiel 2003:XVI).
Zumindest in Annäherung haben wir in verschiedenen Projekten Konzeptbestandteile einer Methodik/Didaktik der Kompetenzentwicklung herausgearbeitet und erprobt. Zwar ohne spezifische Linguismus-Expertise zum Sprachlernen wollen wir einige Erkenntnisse und Erfahrungen beisteuern, die u.E. besonders der Entwicklung einer sozial-kommunikativen Kompetenz dienen können. Als übergreifendes Konzept gilt dabei das der „Lern(prozess)begleitung“ (Bauer et al. 2006), das sich insbesondere durch seine individuelle Lernorientierung und die dialogisch-reflexive Struktur radikal vom Unterweisungslernen absetzt und daher auch in weitere Projekte eingeflossen ist. Eine Grundlage hierfür bildet auch die Beschäftigung mit dem Erfahrungsgeleiteten LernenLernenerfahrungsgeleitetes , dessen Sprache sehr direkt auf die für die Kompetenzentwicklung so bedeutsamen Kategorien eines objektivierenden und eines subjektivierenden Handelns und Lernens hinweist (s. Bauer 2007).
2.2.1 Das Beispiel „Lernbegleitung“LernbegleitungMethode
Geht man vom Ziel der Kompetenzentwicklung aus, erfolgreich komplexe physische wie geistige Handlungssituationen bewältigen zu können, die ohne Selbstorganisationsprozesse nicht zu bewältigen wären, sieht man sich mit einem pädagogischen Paradoxon konfrontiert: Lernende müssen in eine Situation gebracht werden, deren Bewältigung sie ja erst lernen sollen. Dies bedeutet für die Lernenden eine Belastung. Sie benötigen deshalb eine einfühlsame Begleitung. Diese Lernbegleitung ist eine gesprächsbasierte BegleitmethodeMethodegesprächsbasierte Begleit- des Lernens, die dem Lernenden Angebote macht und ihm hilft, diese auf- und anzunehmen, damit er sein Können und Lernen verbessern kann. Sie besteht aus den folgenden, logisch aufeinanderfolgenden Schritten bzw. Phasen:
| 1. Individuellen Lernbedarf feststellen: |
| In einem Lernbedarfsgespräch tauschen sich Lernender und Lernprozessbegleiter über Selbst-/Fremdbeobachtung, Anforderungen und eigene Ziele aus. Ergebnis ist ein gemeinsam vereinbarter Lernbedarf. |
| 2. Lernweg entwickeln: |
| Er besteht in einer Arbeit/Aufgabe, die es dem Lernenden ermöglicht, seinen Lernbedarf zu decken. Sie soll jene Kompetenzen herausfordern, die der Lernende erwerben will. Dafür muss sie ausreichend komplex und problemhaltig sein. |
| 3. Lernvereinbarung treffen: |
| Lernender und Lernprozessbegleiter treffen eine Vereinbarung darüber, wie der Lernweg beschritten werden soll. Ggf. gleich damit verknüpft: |
| 4. Aufgabe zum Lernen aufbereiten und übergeben: |
| Ziel ist die möglichst selbständige Bearbeitung der komplexen Aufgabe. Dazu muss sie speziell für den Lernenden aufbereitet werden. Folgende Instrumente stehen dazu zur Verfügung: Erkundungsaufgaben : Sie leiten den Lernenden dazu an, die nötigen Informationen zu recherchieren und sich das nötige Wissen selbständig zu erarbeiten. Lernarrangement : Die komplexe Arbeitsaufgabe soll auf den individuellen Lernenden zugeschnitten werden (variiert werden dabei vor allem die Vorgaben für die Bearbeitung). Kontrollpunkte : vereinbarte Gespräche zur Abstimmung zwischen Lernendem und Begleiter, z.B. nach Abschluss der Planung, vor wichtigen Schritten, und jederzeit nach Bedarf. Ziel: kontinuierliche Reduzierung der Kontrollpunkte, der Lernende soll selbständig werden. |
| 5. Begleitung des Lernprozesses: |
| Vor allem durch „aktive Passivität“ des Lernbegleiters. Aktiv ist er in seiner Passivität darin, den Lernenden zu beobachten, ihn mit den richtigen Fragen auf eine weiterführende Lösungsspur zu bringen. Ansonsten geht es um „Heraushalten“. |
| 6. Auswertung des Lernprozesses: |
| Wenn Lernenden unklar bleibt, was sie durch die Bewältigung einer komplexen Aufgabe gelernt haben, bleibt das Lernen implizit. Lernender und Begleiter führen daher ein auf den Lernprozess rückblickendes Auswertungsgespräch . Das Erlebte wird zur Erfahrung, das Gelernte zur bewussten Kompetenz. |
Übersicht 1: Lernbegleitung als dialogischer Lehr-/Lernprozess (vgl. Bauer et al. 2006; Bauer & Dufter-Weis 2012)Methodeder Lernbegleitung
Der Lernende ist an der Gestaltung aller Phasen seines Lernprozesses maßgeblich beteiligt. Von höchster struktureller Bedeutung sind die Echtheit des „Lernarrangements“ (reale Arbeitsaufgaben) und methodisch-didaktisch die dialogischen (inkl. feedback- und reflexionsorientierten) Elemente, die als Lernbedarfsgespräch, Vereinbarungsgespräch, als Zwischengespräche an Kontrollpunkten, als Feedback zwischendurch und als Auswertungsgespräch am Ende alle Phasen des Lernprozesses durchziehen.
Sozial-kommunikatives Handeln ist somit nicht Curriculum, sondern integrativer Strukturbestandteil des LernprozessesLernensozial-kommunikatives – der durchaus auch dem Erwerb fachlicher Sprachkompetenzen dienen kann.
Читать дальше