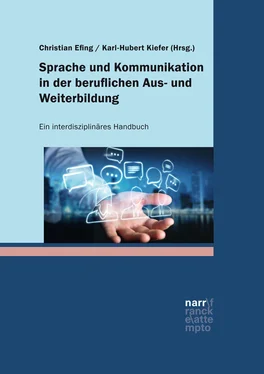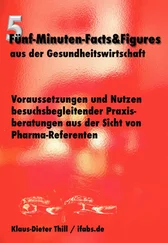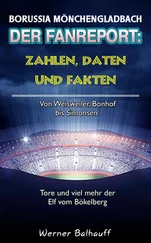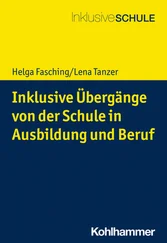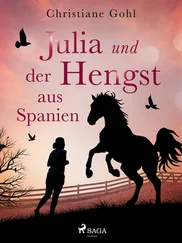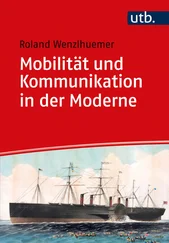Berufsbildungsgesetz (BBiG). Abrufbar unter: http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html (Stand: 18/09/2018)
Blaß, Katharina/Himmelrath, Arnim (2016). Berufsschulen auf dem Abstellgleis . Wie wir unser Ausbildungssystem retten können. Hamburg: Körber-Stiftung.
Bolder, Axel/Dobischat, Rolf/Kutscha, Günter/Reutter, Gerhard (Hrsg.) (2012). Beruflichkeit zwischen institutionellem Wandel und biographischem Projekt . Wiesbaden: Springer VS.
Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.) (2016). Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2016 . Bielefeld: W. Bertelsmann.
Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) (2016). Berufsbildungsbericht 2016 . Bonn: BMBF.
Deißinger, Thomas (1998). Beruflichkeit als „organisierendes Prinzip“ der deutschen Berufsausbildung . Markt Schwaben: Eusl.
Dummert, Sandra/Leber, Ute (2016). Betriebliche Berufsausbildung und Weiterbildung in Deutschland. Abrufbar unter: https://www.bibb.de/dokumente/pdf/a2_iab-expertise_2016.pdf (Stand: 18/09/2018)
Georg, Walter (2008). Studium und Beruf. In: Jäger, Wieland/Schützeichel, Rainer (Hrsg.). Universität und Lebenswelt . Wiesbaden: VS Verlag, 84–117.
Greinert, Wolf-Dietrich (1999). Berufsqualifizierung und dritte Industrielle Revolution . Baden-Baden: Nomos.
Handwerksordnung: Gesetz zur Ordnung des Handwerks (HwO). Abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/hwo/BJNR014110953.html (Stand: 18/09/2018)
Harney, Klaus (1997). Geschichte der beruflichen Bildung. In: Harney, Klaus/Krüger, Heinz-Hermann (Hrsg.). Einführung in die Geschichte der Erziehungswissenschaft und der Erziehungswirklichkeit . Opladen: Leske + Budrich, 209–245.
Krüger, Michael (2014). Die Abschlussprüfung in der dualen Ausbildung aus Sicht der Berufsschule. Die berufsbildendende Schule 66:2, 59–62.
Kultusministerkonferenz (2009). Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 06.06.2009 . Bonn: KMK.
Kultusministerkonferenz (2011). Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit den Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsordnungen . Bonn: KMK.
Kultusministerkonferenz (2013). Rahmenvereinbarung über die Berufsfachschulen. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 17.10.2013 . Bonn: KMK.
Kultusministerkonferenz (2015a). Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland 2013/14 . Bonn: KMK.
Kultusministerkonferenz (2015b). Rahmenvereinbarung über die Berufsschule. Beschluss der Kultministerkonferenz vom 12.03.2015 . Bonn: KMK.
Kutscha, Günter (2010). Berufsbildungssystem und Berufsbildungspolitik. In: Nickolaus, Reinhold/Pätzold, Günter/Reinisch, Holger/Tramm, Tade (Hrsg.). Handbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik . Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 311–322.
Kutscha, Günter (2015). Erweiterte moderne Beruflichkeit. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 29. Abrufbar unter: http://www.bwpat.de/ausgabe29/kutscha_bwpat29.pdf (Stand: 18/09/2018)
OECD (2016). Bildung auf einen Blick. Ländernotiz: Deutschland. Abrufbar unter: https://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/EAG2016-Germany.pdf (Stand: 18/09/2018)
Schanz, Heinrich (2006). Institutionen der Berufsbildung . Baltmannsweiler: Schneider.
Schanz, Heinrich (2015). Berufliche Schulen als Bildungsinstitutionen – ein Überblick. In: Seifried, Jürgen/Bonz, Bernhard (Hrsg.). Berufs- und Wirtschaftspädagogik . Baltmannsweiler: Schneider, 71–90.
Spöttl, Georg (2016). Das Duale System der Berufsausbildung als Leitmodell . Frankfurt a.M. u.a.: Lang.
Statistisches Bundesamt (2016). Berufliche Schulen. Schuljahr 2015/2016. Fachserie 11, Reihe 2. Wiesbaden. Abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Schulen/BeruflicheSchulen.html (Stand: 18/09/2018)
A Disziplinen und Akteure
Ein Blick aus der Ausbildungsforschung
Hans G. Bauer & Nicolas Schrode
Hinter dem begrifflichen Wandel steht ein Wandel des zu Begreifenden.
Erpenbeck 1996:9
Seit der sogenannten kompetenzorientierten Wende der 1990er Jahre stellen sich für die berufliche Aus- und Weiterbildung neue Fragen gerade auch an den Komplex Sprache und Kommunikation in der beruflichen Bildung. Es ist vor allem der Kompetenzgedanke, der die bislang übliche Methodik/Didaktik und damit verbundene (Lehr-/Lern-)Haltungen zum Gegenstand des arbeitswissenschaftlich-/berufspädagogischen Diskurses und der Veränderungsbemühungen gemacht hat. Hoch interessant dabei, dass der Kompetenzansatz hinsichtlich seiner ideengeschichtlichen Wurzeln auf maßgeblichen Grundlagenarbeiten von Sprachwissenschaftlern (insb. N. Chomsky‘s „competence/performance“) basiert. Der sozial-kommunikativen Kompetenz kommt in allen beruflichen Handlungsfeldern immer größere Bedeutung zu.
These : Formal-funktionalistische, linguistische Spracherwerbskonzepte reichen nicht mehr aus, wenn es um den Erwerb von Kompetenzen geht. Denn Kompetenzentwicklung fordert und spricht durch ihre benötigte Methodik/Didaktik und Haltung eine eigene Sprache. Wer (sprachliche) Kompetenzen entwickeln und fördern will, muss selbst die „Sprache der Kompetenzentwicklung“ sprechen. Dies gilt für den Lehrenden und dessen persönliche (Sprach-)Haltung, wie auch für die besonderen methodisch-didaktische Strukturen, die er sprechen lässt. Eine solche Sprache wird jedoch noch nicht überall gesprochen.
1. Ein Blick auf „Sprach“-Entwicklungen
1.1 Unterweisung als Methodenikone des Taylorismus
Der Notwendigkeit, sich sprachlich mitteilen zu können, kam in tayloristisch geprägten Arbeitsstrukturen relativ geringe Bedeutung zu. Bezogen auf die berufliche Aus- und Weiterbildung spiegelt das die vorherrschende sogenannte Vier-Stufen-Methode, die einen ähnlich methodisch-ikonischen Rang erreicht hat(te) wie der Frontalunterricht in der schulischen Bildung: Die „unterweisende“ DominanzfigurUnterweisung des Ausbilders (in männlicher Rollenvorherrschaft) bereitet die Lehr(!)situation durch Erklärung vor (Stufe 1), macht das zu Erlernende vor (Stufe 2), was der/die Lernende dann nachmacht (Stufe 3), welches dann vertieft wird (Stufe 4)Lernendurch Nachahmen. Zwar zunächst am Arbeitsplatz eingesetzt, wurde dieser berufliche Lehransatz dann, der schulischen Trennung von Leben und Lernen folgend, insbesondere in industriellen Zusammenhängen in dafür geschaffenen Lehrwerkstätten praktiziert. Auch wenn dabei dem Tun und Üben eine wichtige Rolle zukommt: Lerntheoretische Patenfiguren sind vor allem der Behaviorismus, der Instruktionalismus, die Wissensdominanz des Lerndenkens. Arbeitsorganisatorisch spiegeln sich klare, steile Hierarchien, die Vorherrschaft des Fachwissens und anweisungsbezogene Kommunikationsstrukturen, kurz: die Erfordernisse des dominierenden Tätigkeitstypus „herstellender Arbeit […] für den die wesentlichen Kompetenzen der Mehrheit der Beschäftigten arbeitsintegriert nach dem Prinzip ‚Anschauen und Nachahmen‘ in betrieblichen Ausbildungsprozessen vermittelt werden konnte, ohne dass ein hohes kognitives Niveau der Auszubildenden erforderlich gewesen wäre“ (Baethge 2011:16).
Die „Sprache der Unterweisung“, so könnte man zusammenfassen, zeichnet sich aus durch Direktivität (Befehlen, Anordnen, Kritisieren, einseitiges Fragenstellen, Irreversibilität der Aussagen). Ein Wissender spricht im Habitus eines Wissenden mit einem Unwissenden, der sich in diesem Verhältnis von Dominanz und Subordination in den Habitus des Unwissenden zu begeben hat und sich in die Abhängigkeit des Wissenden begibt.
Читать дальше