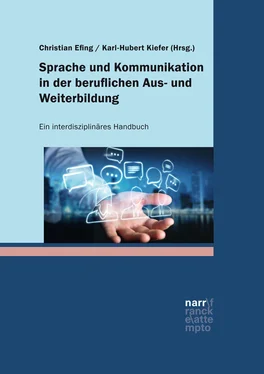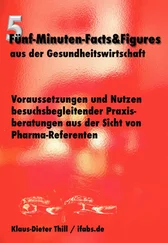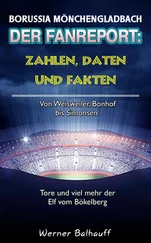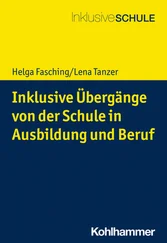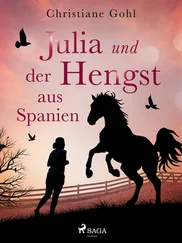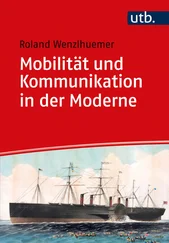1.2 Die Schlüsselqualifikationsdebatte
Mit der „Schlüsselqualifikationsdebatte“Qualifikation der 1980er Jahre hat die Berufsbildung auf die massiv eingetretenen Wandlungsbedingungen in der Arbeitswelt reagiert. Vor allem die Veränderungen hin zu einer wissensbasierten Dienstleistungsökonomie weisen auf grundlegend neue Qualifikationsanforderungen hin. War in der älteren Qualifikationsforschung noch die Rede von der wachsenden Bedeutung extrafunktionaler/prozessunabhängiger Qualifikationen, ging es danach um fachübergreifende „Schlüssel“-Qualifikationen, die zur Erschließung von sich schnell änderndem Fachwissen und zur Selbstanpassung an neue Arbeitssituationen genutzt werden können. Die „Neuordnungen“ verschiedener Berufe (1987) nimmt Elemente des „selbständigen beruflichen Handelns“ auf, womit sich ein Paradigmenwechsel in der Aufgabenstellung der beruflichen Bildung andeutet: von einem Ort der Fachqualifizierung hin zu einem Medium der Persönlichkeitsbildung bzw. -entwicklung (vgl. Brater & Bauer 1992:50–69).
Folgt man der Baethge’schen Diagnose über die Veränderung der Tätigkeitsstrukturen, lassen sich „zwei qualifikatorische Basisdimensionen ausmachen, die zunehmende Bedeutung besitzen: Kommunikationsfähigkeit und Wissen . Beide gehen bei moderner Dienstleistungsarbeit eine Kombination ein und erlangen einen neuen Stellenwert.“ Er „resultiert aus dem Zusammenhang von interaktiver (Dienstleistungs-)Arbeit und dem fortgeschrittenen Stadium der Wissensbasierung aller Arbeits- und Kommunikationsprozesse. […] Kommunikationsfähigkeit wird als fachübergreifende Kompetenz bei interaktiver Arbeit die Basiskompetenz (Baethge 2011:17).kommunikative Kompetenz
Angesichts der Neukonstituierung der Arbeits- wie Lernwelten, die von „offenen Entwicklungstendenzen“ und „komplexen Ungleichzeitigkeiten der Bewegung“ (Kirchhöfer 2004:13) gekennzeichnet sind, hat sich der Schlüssel -Gedanke der fachübergreifenden Perspektive als fruchtbar erwiesen. Schwieriger verhält es sich mit den Qualifikationen . Die Ermittlung eines Qualifikationsbedarfs ergab/ergibt sich üblicherweise aus den unternehmerischen Zielvorgaben und den aktuellen Qualifikationsdefiziten. Hier fließen zwei Problematiken zusammen: Zum einen die Annahme eines „linearen Transformationsprozesses“ (Schäffter 1998:25) – des Übergangs von einem bekannten Zustand A in einen bekannten Zustand B – der in den Betrieben tendenziell in kürzeren Intervallen erfolgt. Dem folgte (und folgt) die betriebliche Bildungsarbeit durch die Vermittlung formaler fachlicher und sozialer Qualifikationen. Trotz des Additivs „sozial“ verbleibt jedoch die zweite Problematik des QualifikationsdenkensLernennach Schablone: QualifikationenQualifikation orientieren sich an einem Maßstab, der von einem Menschen erfüllt werden muss, um einer Tätigkeit nachzugehen. Sie sind daher Konstrukte, die, wenn sich die qualifikatorische Bedingung verändert, „nur noch Aussagen über denjenigen zu treffen vermögen, der sie als Maßstab verwendet, nicht unbedingt jedoch über den, an den das Maß angelegt wird“ (Lang-von Wins & Triebel 2006:38). Letzterer tritt damit immer als Qualifikationsdefizit in Erscheinung.
In der „Sprache des Qualifikationsdenkens“ kommt dem Wissen und den formalen Formen des Erwerbs große Bedeutung zu. Beurteilung und Defizitorientierung sind wichtiger als Ressourcenorientierung. In den Vordergrund rückt der Begriff der Vermittlung . Positiv gesehen beinhaltet er ein Kommunikationsverhältnis, das ein herzustellendes Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden im Blick hat. Oft aber bleibt es beim Begriffsaustausch: Unterweisung heißt jetzt Vermittlung .
1.3 Kompetenzorientierte Wende
Mit der sogenannten Kompetenzorientierten WendeKompetenz-Orientierung etwa ab Beginn der 1990er Jahre wurde ein Leitbegriff adaptiert, der geeignet schien, die Herausforderungen zunehmender wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Individualisierung, Beschleunigung, Globalisierung, der Virtualisierung organisatorischer Strukturen u.ä. aufgreifen zu können. Auch sollte den Menschen in den neuen Bundesländern mit der Qualifizierungsoffensive verdeutlicht werden, dass „mit der Arbeit an neuen Werthaltungen und Einstellungen begonnen werden sollte“ (Kirchhoff 2007:85). Begriffe wie Werte und Haltungen stehen dem subjektzentrierten Kompetenzverständnis sehr nahe. Letzteres rückte in den Vordergrund:
Die alte Bildungslogik muss […] ergänzt werden durch eine neue Logik, die auf die Entdeckung und Entwicklung der individuellen Kompetenzen bei den Beschäftigten in der Aus- und Weiterbildung setzt (Wittwer 2015:7).
Im Kern geht es dem Kompetenzansatz daher um die Hinwendung zum arbeitenden und lernenden Subjekt .
Damit steht die jeweilige Besonderheit der Person, d.h. deren individuelle Kompetenzen im Vordergrund der Bildungsarbeit. Nur so kann das individuelle Potenzial im Sinne des Individuums, der Organisation bzw. des Unternehmens sowie der Gesellschaft genutzt werden (Wittwer 2015:3).
Kompetenzen stellen immer „das Individuum in den Fokus der Betrachtung“ (Lang-von Wins & Triebel 2006:39). Die Begrifflichkeit z.B. der „Selbstorganisationsdisposition“ Selbstorganisationsdisposition(Erpenbeck & Rosenstiel 2003: XXXI) verweist darauf, dass Fertigkeiten, Fähigkeiten, Wissen und Qualifikationen zwar unumgängliche Voraussetzungen, für sich genommen aber noch keine Kompetenzen sind.
Das, was Kompetenzen ausmacht, beinhaltet immer auch Hinweise auf die spezifischen Bedingungen ihres Erwerbs: Die Selbstorganisationsdisposition muss durch Handlung zum Leben, zur Sprache kommen. Da es bei Kompetenzen um die Bewältigung komplexer Anforderungen geht, benötigt man zu ihrer Entwicklung Lernsituationen mit direktem Praxisbezug, möglichst ein Lernen in Realsituationen. Über Wissen, Fertigkeiten und Qualifikationen hinausgehend sind auch „interiorisierte, also zu eigenen Emotionen und Motivationen verinnerlichte Regeln, Werte (Bewertungen) und Normen“ (ebd.:XXXI) Kernbestandteile von Kompetenzen. Damit wird der Wertebereich zum zentralen Drehpunkt des SubjektbezugsSubjektbezug des Kompetenzansatzes. Auf emotional gesättigte Erlebens- und Erfahrungssituationen als „Grundlagen des Kompetenzerwerbs“ (Arnold & Erpenbeck 2014:13) kommen wir noch zurück.
Der Kompetenzbegriff ist heute zu einem „Containerbegriff“ geworden, „in den man alles hineinpacken kann“ (Wittwer 2015:10). Vielfach besteht die kompetenzorientierte Wende in einer schlichten Umbenennung bisher benutzter Fähigkeits- und Qualifikationsbegriffe. Auch in diesem Band trifft man vielfach auf Kompetenzgebilde wie Sprach-, Gesprächs-, Kommunikations-, Erklärungs-, Schreib-, Lesekompetenz u.ä.m., bei denen es sich eher um Voraussetzungen für Kompetenzen handelt, nicht aber um Kompetenzen selbst. Das Verständnis von Kompetenz scheint sich „trotz gegenteiliger Beteuerung“ wieder in Richtung Qualifikation zu bewegen. Es geht jetzt „weniger um die Entwicklung ganz persönlicher Kompetenzen als um den Erwerb gesellschaftlicher bzw. betrieblich erwünschter Kompetenzen“, um den „Wunsch nach einer ‚sicheren‘ Prognose des menschlichen Verhaltens im Arbeitsprozess und dem Einsatz der Kompetenzen als betriebliches Steuerungsinstrument. […] Dieser Wunsch steht allerdings im Widerspruch zum Subjektbezug des Begriffs.“ (Wittwer 2015:11).
2. Sprache, Kommunikation und Kompetenzentwicklung
2.1 Kompetenzentwicklung/-reifung
Kompetenzen benötigen ihrer besonderen Merkmale wegen zu ihrer Entwicklung – Arnold & Erpenbeck sprechen sogar von „Kompetenzreifung“ – auch eine eigene Methodik/DidaktikKompetenzreifungMethodik der. Einige Stichworte hierzu haben wir bereits skizziert. Einem konkreten methodisch/didaktischen Konzept bereits näher kommen u.E. die folgenden Anregungen, die einem – akademisch sehr unüblich – in einem gemeinsamen Band publizierten Dialog (!) entstammen (Arnold & Erpenbeck 2014:57f.):
Читать дальше