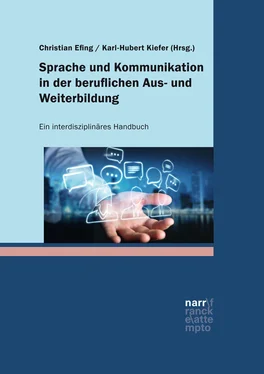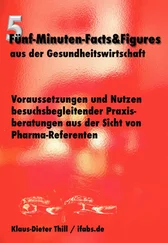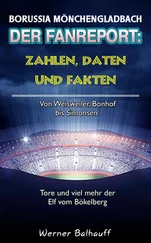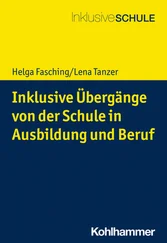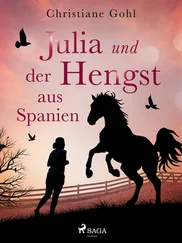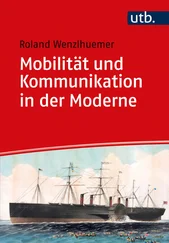Die Perspektive der Wirtschaft
Helmut E. Klein & Sigrid Schöpper-Grabe
Wirtschaftliches Handeln bedingt immer auch zweckgerichtetes sprachliches Handeln. Ohne ausreichende Sprachbeherrschung gelingt keine erfolgreiche Kommunikation am Arbeitsplatz oder mit Kunden und Geschäftspartnern. Sprache ist die Basis für Vertragsverhandlungen, für die Präsentation von Produkten und für die Werbung. Da Unternehmen Institutionen sind, gelten formelle institutionelle Regelungen für das Handeln – auch für das sprachliche Handeln. Neben einheitlichen fachsprachlichen Benennungen sowie standardisierten Berichts- und Kommunikationsformen findet betriebliche Kommunikation zweifelsfrei auch auf informellem Wege statt (Brünner 2000:10). Damit ist Sprache ein unabdingbares Medium der Interaktion und Kommunikation in Unternehmen – und erklärt, weshalb die Fähigkeit verstehend zuzuhören, zu sprechen, zu schreiben und zu lesen nicht nur in der Schule, sondern auch in der Aus- und Weiterbildung unverzichtbar und Gegenstand des Lernens ist.
Allerdings wird der hohe Stellenwert von Sprache in Unternehmen als Voraussetzung reibungsloser Kommunikation häufig erst dann erkannt, wenn Störungen entstanden sind und es zu Reibungen, Konflikten oder Fehlern kommt. Es sind vor allem diese Formen von Betriebsstörungen aufgrund defizitärer Sprachkompetenzen, die den Blick der Wirtschaft auf notwendige sprachliche Fähigkeiten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Prämisse funktionierender betrieblicher Kommunikation gelenkt haben. Dabei steht außer Zweifel, dass Unternehmen sehr genau wissen, welche Mindestanforderungen sie an die sprachlichen Fähigkeiten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen (Klein & Schöpper-Grabe 2012a, 2012b).
Fördern Unternehmen unzureichende grundlegende sprachliche Kompetenzen in der Aus- und Weiterbildung, um die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeterinnen und Mitarbeiter zu sichern, verweist dies auf eine nicht erfüllte „Bringschuld“ des Schulsystems. Denn die originäre Verantwortung für die Vermittlung grundlegender sprachlicher Fähigkeiten ist in dem kodifizierten Bildungsauftrag und dem Qualitätsversprechen schulischer Bildung gemäß der Qualifikationsfunktion von Schule (Fend 1980) verankert. Wenn Unternehmen die Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten für Beschäftigte unterschiedlicher Hierarchieebenen und Funktionen an (höhere) betriebliche Anforderungsniveaus anpassen, handelt es sich um Maßnahmen im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung.
Der vorliegende Beitrag legt den Fokus auf die basalen sprachlichen und kommunikativen Kompetenzen aus Sicht der Wirtschaft. Die Ausführungen orientieren sich dabei an den Ergebnissen verschiedener Unternehmensbefragungen (Klein & Schöpper-Grabe 2012a) und empirischer Überprüfungen der vorhandenen Sprachkompetenzen (Grotlüschen & Riekmann 2011, Rammstedt 2013) von Schulabsolventen und Erwachsenen. Danach werden die sprachlichen MindestanforderungenMindestanforderungen der Wirtschaft an Ausbildungsplatzbewerber (Klein & Schöpper-Grabe 2012a) und an GeringqualifizierteGeringqualifizierte (Schöpper-Grabe 2012b) zur Diskussion gestellt (Klein & Schöpper-Grabe 2015). Diese nachschulische Vermittlung von SprachkompetenzenSprachkompetenzen ist nicht nur individuell und gesellschaftspolitisch, sondern auch (bildungs-)ökonomisch betrachtet zeitaufwendig und kostenintensiv und stellt ein Beschäftigungshemmnis für geringqualifizierte Erwachsene und Unternehmen dar. Abschließend beleuchtet der Beitrag mögliche Qualifikationsansätze sowie den bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Handlungsbedarf zur Sicherung basaler sprachlicher Kompetenzen.
2. Sprachliche Kompetenzen von Schulabgängern im Spiegel von Unternehmensbefragungen
Dass die sprachlichen Kompetenzen sowohl von Auszubildenden als auch von erwerbstätigen Erwachsenen teilweise erhebliche Schwächen aufweisen, ist kein vereinzelter Befund (Ehrenthal et al. 2005, Klein & Schöpper-Grabe 2009, 2012a, 2012b). Bereits seit mehr als zwanzig Jahren sind diese Ergebnisse sowohl durch Unternehmensbefragungen als auch durch empirische Überprüfungen der vorhandenen Kompetenzen oder durch Einstellungstests von Unternehmen dokumentiert. Schon Mitte der 1990er Jahre unterstrich eine bundesweite Unternehmensbefragung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln 1997), dass rund jede vierte Lehrstellenbewerberin und jeder vierte Lehrstellenbewerber für eine Ausbildung nicht oder nur bedingt geeignet ist. Etwa zehn Jahre später belegte der Expertenmonitor des Bundesinstituts für Berufsbildung (Ehrenthal et al. 2005), dass die Rechtschreibung (87 %) und schriftliche Ausdrucksfähigkeit (85 %) die Liste der festgestellten Mängel von Schulabsolventen anführen.
Auch in der Ende 2010 vom IW Köln (Klein & Schöpper-Grabe 2012a:48) durchgeführten repräsentativen Online-Unternehmensbefragung werden bei der Frage nach den GrundbildungsdefizitenGrundbildungsdefizite von Ausbildungsbewerberinnen und Ausbildungsbewerbern am häufigsten die Rechtschreibung und Zeichensetzung (93 %) sowie die schriftliche Ausdrucksfähigkeit (91 %) genannt. Danach folgen zum Beispiel Defizite in der Dreisatz- und Prozentrechnung (78 %) oder in den Sozial- und Selbstkompetenzen (74 %). Nach wie vor sind Lesen und Schreiben – trotz und auch gerade wegen der neuen Technologien – in der Berufsausbildung unverzichtbar. Zwar sind die Anforderungen an das für die berufliche Ausbildung erforderliche Sprachniveau durchaus unterschiedlich, zum Beispiel im Vergleich von gewerblich-technischen Auszubildenden und kaufmännischen Auszubildenden, aber ohne ausreichende schriftsprachliche Kompetenzen ist eine Berufsausübung kaum möglich. In einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages gaben etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen an, dass sie Defizite in Deutsch bei den Auszubildenden festgestellt haben – gefolgt von 44 % der Unternehmen, die Schwächen der Ausbildungsplatzbewerberinnen und Ausbildungsplatzbewerber in Mathematik konstatierten (DIHK 2015:20).
Obwohl in Deutschland eine mindestens neunjährige Schulpflicht in einem hoch entwickelten Schulsystem besteht, verlassen nach wie vor jährlich zu viele junge Menschen die Schule ohne ausreichende Kompetenzen im Lesen, Schreiben und Rechnen. Nach der internationalen PISA-Studie traf dies 2012 auf jeden siebten Schüler und jede siebte Schülerin zu (OECD 2014). Die Defizite, die beim Übergang von der Schule in den Beruf vorhanden sind, beheben sich im Laufe der Erwerbstätigkeit nicht von allein, sondern bleiben dauerhaft, wenn keine nachholenden unterstützenden Maßnahmen ergriffen werden. So bieten nach der DIHK-Umfrage 36 % der Unternehmen bereits Nachhilfe zur Kompensation von Defiziten für schwächere Auszubildende an (DIHK 2015). Im Vergleich zum Vorjahr war dieser Anteil um fünf Prozentpunkte gestiegen. Allerdings ist es nicht die Aufgabe von Unternehmen, Literalitätsmängel der Auszubildenden zu beheben, sondern das Schulsystem hätte dies verhindern müssen.
3. Sprachliche Kompetenzen: Befunde aus empirischen Kompetenzüberprüfungen
Nicht nur aus Sicht von Unternehmen werden sprachliche Schwächen am Übergang Schule-Beruf bzw. bei erwerbstätigen Erwachsenen konstatiert, sondern auch nationale (Grotlüschen & Riekmann 2011) und internationale Studien (Rammstedt 2013) der Kompetenzüberprüfung kommen zum Ergebnis, dass Erwachsene ohne ausreichende Lesekompetenzen und alltagsmathematische Kompetenzen große Probleme haben, erfolgreich am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und sich spezielle berufliche Kompetenzen anzueignen. Nach der PIAAC-Studie (Rammstedt 2013) – das Akronym steht für Programme for the International Assessment of Adult Competencies – liegt der Anteil der Erwachsenen mit mangelnder Lesekompetenz in Deutschland im Durchschnitt bei 17,5 %. Zudem weist der Befund, dass es in Deutschland 7,5 Millionen funktionale Analphabeten – also Menschen mit eingeschränkten Lese- und Schreibfähigkeiten (Grotlüschen & Riekmann 2011) – gibt, auf die langfristigen Folgen von schulischen Defiziten für die Erwerbstätigkeit und Beschäftigungsfähigkeit hin.
Читать дальше