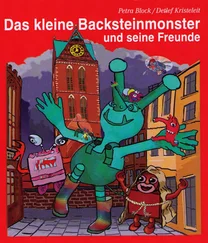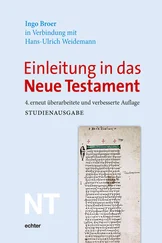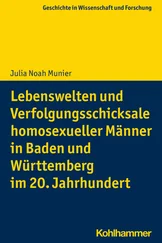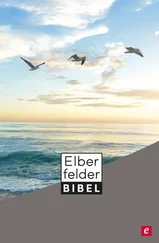Man kann Trobisch lediglich entgegenhalten, dass er die Hypothese einer kritischen Diskussion über eine bestehende Sammlung an den Quellen selbst nicht ausführlich durchgespielt,7 sondern nur knapp skizziert hat. Vor allem die früh bezeugte Diskussion über die paulinische Verfasserschaft des Hebräerbriefes8 erklärt sich viel einfacher, wenn man seine Zugehörigkeit zu einer Paulusbriefsammlung annimmt, da aus dem Text selbst heraus die paulinische Verfasserschaft bekanntermaßen gar nicht erschlossen werden kann.9 Darüber hinaus ist es erstaunlich, wie gut die von Trobisch auf der Grundlage des Handschriftenbefundes vorausgesetzten Sammlungseinheiten (e a p r)10 auch in den Quellen belegt sind. Nur deshalb kann T. Zahn die frühe Existenz eines ideellen Kanons postulieren.11
Man braucht demgegenüber schon einen großen argumentativen Aufwand, um einen Abschluss des vermeintlichen Sammlungs- und Ausscheidungsprozesses mit Athanasius’ 39. Osterfestbrief ins 4. Jh. zu datieren. Der These, der Sammlungsprozess sei erst bei Athanasius abgeschlossen, stehen nämlich zwei Zeugnisse entgegen, die man entweder wegerklären oder sich passend machen muss: So muss man etwa Orig. hom. in Jos 7,1 als Interpolation des Rufinus verstehen12 und die von Euseb angelegten Kategorien zur Systematisierung der neutestamentlichen Schriften gegen den Strich bürsten.13 Gerade an diesen beiden Quellen kann man die in den Handschriften belegten Sammlungseinheiten besonders gut ablesen:
Orig. hom. in Jos 7,1: vier Evangelien in der Reihenfolge Mt, Mk, Lk, Joh; die Apg wird losgelöst vom Evangelium mit den wahrscheinlich sieben katholischen Briefen zusammen genannt (zwei Petrusbriefe, Jakobus und Judas, Anzahl der Johannesbriefe nicht genannt); Vierzehnbriefesammlung des Paulus.14 Dass im Übrigen Origenes an anderer Stelle (hom. in Gen 13,2) die acht Autoren der neutestamentlichen Schriften in der Reihenfolge Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Petrus, Jakobus, Judas und Paulus aufzählt, die den Brunnen des Neuen Testaments gegraben hätten, deutet ebenfalls darauf hin, dass ihm das Neue Testament in Form der von Trobisch herausgearbeiteten Sammlungseinheiten vertraut war. Auch an der Diskussion der neutestamentlichen Bücher bei Euseb (Eus. h. e. 2,23,24f.; 3,25,1ff) lassen sich die Sammlungseinheiten sehr schön ablesen, wobei diese Aufzählung nach den Kriterien der Echtheitskritik in akzeptierte (ὁμολογούμενος), bezweifelte (ἀντιλεγόμενος) und gefälschte (νόθος) Schriften noch einmal untergliedert ist. A. D. Baum hat die Relationalität dieser Kategorien mit philologisch präziser Begründung differenzierend beschrieben: So unterscheidet Euseb „zwischen solchen Antilegomena, die er nicht für echt hielt (νόθοι), und solchen, die er damit implizit als γνήσιος einstuft.“15 Dabei ist auffällig, dass Euseb keine der 27 neutestamentlichen Schriften den νόθοι zuordnet. Es ist zu beachten, dass Euseb nicht die Reihenfolge der Schriften in den Handschriften diskutiert. Euseb reiht die Schriften nach dem Prinzip der Echtheit, nicht aber nach den vorliegenden Sammlungseinheiten. Dass die Sammlungseinheiten in diesen weniger deskriptiv als normativ orientierten Aufzählungen dennoch durchscheinen, ist daher umso aussagekräftiger.
Auch andere Quellen16 weisen auf die Konstanz der Sammlungseinheiten hin:
Zu verweisen wäre z. B. auf Kyrill von Jerusalem (catech. 4,36); Athananasios von Alexandria (epist. fest. 39); den in seiner Ursprünglichkeit umstrittenen 60. Kanon des Konzils von Laodicea;17 Chrysostomos (synopsis Script. Sacr.; PG 56 317); Augustinus (de doctr. Christ. 2,8,13); Innocentius in seinem Brief an Exsuperius, den Bischof von Toulouse;18 Cassiodor (instit. 24); Johannes von Damaskus (de fide Orthod. 4,17). Auch wenn in einigen dieser Quellen die Apg nach den katholischen Briefen aufgeführt wird, so sind die Sammlungseinheiten dennoch klar erkennbar. Anstelle von vier Ordnungen19 kommt eine teilsammlungssensible Kategorisierung lediglich auf zwei Ordnungen. Die weiteren von Zahn postulierten Ordnungen sind lediglich als Umordnung der Sammlungseinheiten zu interpretieren. Die Stellung der Apg zwischen den Evangelien und der Paulusbriefsammlung, die in den „byzantinischen Handschriften“ des NT dokumentiert ist20, kann m. E. plausibel als sekundäre Umstellung (der lectio difficilior „Praxapostolos“21) interpretiert werden, bei der die narrativen Texte zu einer eigenen Sammlung zusammengestellt werden. Vgl. zu dieser Aufteilung der neutestamentlichen Schriften Gregor von Nazianz (carm. 12,31); Amphilochius (Iambi ad Seleucum);22 Rufinus (Comm. in Symb. Apost. 37);23 zur Aussagekraft des muratorischen Fragments s. die Ausführungen oben. Aus Tert. pud. 7–11 und Iren. adv. haer. 3,11,9–3,12,1 sowie der Art der Zitation der Paulusbriefe in den folgenden Kapiteln abzuleiten, die Apg wäre (gegenüber der Sammlungseinheit „Praxapostolos“ ursprünglich) zwischen den Evangelien und den Paulusbriefen eingeordnet gewesen, ist methodisch schwierig. Denn die Argumentation orientiert sich dort entlang der Chronologie, die durch die Hintergrundnarration des NT geprägt ist.24 Ob bzw. wann die Stellung der Apostelgeschichte nach den Evangelien materialiter realisiert wurde, muss offen bleiben. So zeigt Philastrius haer. 88 – ein eindeutiger Beleg für die Sammlungseinheit „Praxapostolos“25 – eindrücklich, dass die gerade genannte Zuordnung der Apostelgeschichte zu den Evangelien (… et Prophetas et Evangelia et Actus Apostolorum, et Pauli tredecim epistolas …) eine materielle Zusammenstellung nicht zwingend impliziert: … et septem alias, […], quae septem Actibus Apostolorum conjunctae sunt . Ganz eigenwillige Zusammenstellungen bieten dagegen die schwer datierbaren Stichenverzeichnisse im Codex Claromontanus und der sog. Cheltenham-Kanon. Es ist jedoch methodisch schwierig, diese beiden Zeugnisse, deren historischer Aussagewert nur schwer einzuschätzen ist, zur Modellbildung der Entstehung des neutestamentlichen Kanons zu stark zu belasten. Die Aufzählung in Can. Apost. 85 (SC 336 8,47) dokumentiert eine Art (im Rahmen der Ersteditionsthese: sekundär) erweiterte Sammlungseinheit „Praxapostolos“, die zusätzlich zwei Clemensbriefe enthält.26 Darüber hinaus ist die Sammlungseinheit „Praxapostolos“ auch für die koptische Überlieferung und für die Altlateiner belegt (s. u.). Aus dem Quellenbefund insgesamt lässt sich m. E. methodisch nicht sicher ableiten, dass die Apostelgeschichte und die katholischen Briefe später als die Paulusbriefe und die Evangelien in verbindlichere Corpora eingetreten und zunächst als Einzelschriften zirkuliert wären.27 Der recht einheitliche Quellenbefund deutet doch eher darauf hin, die wenigen Abweichungen als Neueditionen zu verstehen, die jeweils aus unterschiedlichen Gründen vorgenommen worden sind. Im Befund der neutestamentlichen Handschriften haben die Abweichungen bis auf die Zusammenstellung der narrativen Texte vor die Briefcorpora jedenfalls keinen Niederschlag gefunden.
Die Quellen, die Trobisch selbst als positive Evidenz für seine These heranzieht, werden von seinen Kritikern zumeist übergangen: z. B. die indirekte und direkte Bezeugung des Titels „Neues Testament“28 und das Zitat des sog. anonymen Antimontanisten bei Euseb, der keinesfalls den Anschein erwecken möchte, „als wollte ich dem Worte der neutestamentlichen Frohbotschaft (τῷ τῆς τοῦ εὐαγγελίου καινῆς διαθήκης λόγῳ) etwas ergänzend beifügen, da doch keiner, der entschlossen ist, nach diesem Evangelium zu leben, etwas beifügen noch abstreichen darf,“ (Eus. h. e. 5,16,3).29
Das gängige Verständnis dieser Stelle in der Forschung, der anonyme Antimontanist würde nicht auf den Titel einer Sammlung, sondern ganz allgemein auf die Botschaft einer als καινὴ διαθήκη gekennzeichneten Ära verweisen,30 ist a) angesichts der Verbsemantik von προστίθημι (vgl. z. B. P. Amh. Gr. 2 77,15) und ἀφαιρέω viel unwahrscheinlicher; vgl. z. B. die gesamte Wendung in Thuc. 5,23, und insb. in Pol. 21,43,27, wo es um einen Vertragstext [συνθήκη] geht. b) Es ist unsachgemäß, Eus. h. e. 5,17 gegen die These in Stellung zu bringen, dass der Antimontanist in Eus. h. e. 5,16,3 auf eine Schriftensammlung verweist. Euseb zitiert hier wiederum den anonymen Antimontanisten, der u. a. formuliert: „Doch wird man weder aus dem alten noch aus dem neuen [ scil. Bund] einen Propheten nennen können, der auf solche Weise vom Geiste ergriffen worden wäre. Sie werden sich nicht auf Agabus oder Judas oder Silas oder die Töchter des Philippus oder Ammia in Philadelphia oder Quadratus oder auf sonst jemanden berufen können; denn mit diesen haben sie nichts zu tun,“ (Eus. h. e. 5,17,3; Üb. HÄUSER; leicht modifiziert JH). Laut C. W. van Unnik könne sich der Antimontanist mit der Wendung τῶν κατὰ τὴν παλαιὰν οὔτε τῶν κατὰ τὴν καινὴν nicht auf Schriftensammlungen beziehen, weil in der darauffolgenden Aufzählung Namen stünden, die nicht in diesen Schriften auftauchten.31 Dazu ist zunächst anzumerken, dass der Begriff διαθήκη im Zitat aus der Schrift des Antimontanisten gar nicht auftaucht, sondern in 5,17,2 von Euseb interpretatorisch eingefügt wird; auch die Annahme, der Antimontanist habe Quadratus und Ammia zu den prophetischen Gestalten des Neuen Bundes gerechnet, entstammt der Interpretationsleistung des Euseb (5,17,2), die man strikt von der Aussage des Fragments trennen muss. Sodann: Soweit man den argumentativen Zusammenhang aus dem Fragment noch erkennen kann, impliziert die Formulierung nicht zwingend, dass alle genannten Namen zum vorher definierten Prophetenkreis gehören. So werden Quadratus und Ammia ja von der Gegenseite eingebracht (ὥς φασιν; 5,17,4), wobei nicht deutlich wird, auf welche „Quellen“ sich die Gegenseite stützt; Agabus (Apg 11,28; 21,10–14), Judas und Silas (Apg 15,22.27.32[!]), und die Töchter des Philippus (Apg 21,9) werden hingegen in der Apg als Propheten bezeichnet. Daher ist die viel einfachere Erklärung, es werde, wie auch in den späteren Quellen, schon vom anonymen Antimontanisten mit dem „Worte der neutestamentlichen Frohbotschaft“ auf den Titel einer Schriftensammlung verwiesen, auch aus Gründen des Sparsamkeitsprinzips vorzuziehen. Ein indirekter Verweis auf das Alte und Neue Testament in 5,17,3 (wodurch sonst sollte man wissen, wer zu den Propheten des Alten und Neuen Bundes gehört?), wäre eingehender zu prüfen.
Читать дальше
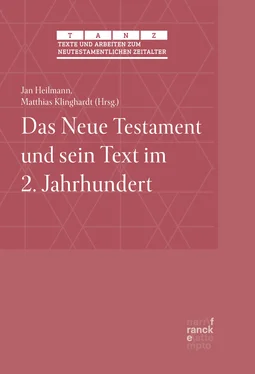

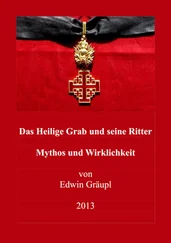
![Felix Sobotta - Das alte Jagdschloss und das neue Haus [Band 1]](/books/493473/felix-sobotta-das-alte-jagdschloss-und-das-neue-ha-thumb.webp)