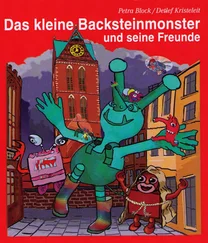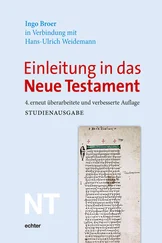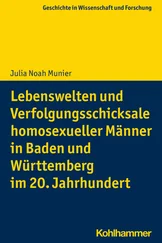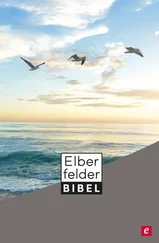Dieser Anfrage möchte ich angesichts der Veränderung in der Forschungslage seit der Herausgabe von Trobischs Habilitationsschrift einige weiterführende Fragen gegenüberstellen: Muss man nicht sogar davon ausgehen, dass „vorkanonische“ Sammlungen wie z. B. eine Paulusbriefsammlung oder die Bibel Marcions in Form eines Kodex herausgegeben worden sind? Ist die Annahme der innovativen Einführung der Kodexform durch den/die Herausgeber der editio princeps eine notwendige Bedingung der These Trobischs? Kann man nicht vielmehr annehmen, dass der/die Herausgeber eine bestehende christliche Editionspraxis von Sammlungen aufnahm und weiterführte? Der Kodex wäre in der frühchristlichen Publikationspraxis damit ja nicht „durch mehrere unabhängig voneinander arbeitende Herausgeber“2 eingeführt worden, sondern einfach nur von Herausgebern und Editoren älterer, vorkanonischer Sammlungen. Dies ändert alles nichts an der Einheitlichkeit des Befundes, auf denen Trobischs Schlussfolgerungen beruhen.
Ergänzt werden können die Schlussfolgerungen durch eine Beobachtung von Scheele an den literarischen Quellen der Alten Kirche. Er resümierte schon in den 1970er Jahren:
„Die Verwendungsart von ‚codex‘ in den hier herangezogenen Schriftstellen […] könnte vermuten lassen, daß sich in der alten Kirche ein bestimmter Aufteilungsmodus der Schriften der Bibel mehr oder weniger einheitlich gebildet hätte. Soweit ich sehen kann, ist diese Frage noch nicht gestellt und untersucht worden“.3
2.2 Im 2. Jh. sei es vor allem unter ökonomischen1 und technischen2 Gesichtspunkten noch nicht möglich gewesen, die neutestamentlichen Schriften in einem Kodex bzw. in einer „Vollbibel“ unterzubringen.
Dieses Argument halte ich aus sozialgeschichtlicher Perspektive für nicht tragfähig – man denke nur an das mutmaßliche Vermögen Marcions oder an die Kosten, die durch die paulinischen Reisen entstanden sein müssen.3 Hinter diesem Argument steckt eine m. E. fragwürdige Vorstellung des frühen Christentums als „subkulturelles Phänomen“4, das vor allem für die Unterschichten attraktiv war und in dem der Austausch biblischer Schriften ausschließlich über private Netzwerkstrukturen abgelaufen ist.5 Dabei wird ein sozialromantisches Bild (das aus dem 1Kor und Thesen zum historischen Jesus abgeleitet wird und schon für das 1. Jh aus vielen Gründen fragwürdig ist) ohne Kenntnis der Verhältnisse auf das 2. Jh. übertragen. Diese weit verbreitete Vorstellung in der Forschung ist ein Grund, warum Trobischs These von einer Publikation neutestamentlicher Schriften als Anachronismus gewertet wird.6 Diese Sicht wird zusätzlich genährt von einer gewissen Skepsis in der altphilologischen Forschung gegenüber den älteren Arbeiten7 zum antiken Buchwesen.8 Allerdings wird in der Arbeit Trobischs auch nicht ganz deutlich, wie er sich die Publikation der christlichen Bibel in vier Teilsammlungen (e a p r) im 2. Jh. rein technisch ganz genau vorstellt9 – als Publikation in einem oder zwei Bänden oder in mehreren Teilbänden.
In der Spätantike sind „Teilausgaben“ der Bibel in Kodexform ikonographisch10 und in den literarischen Quellen bezeugt. Es wäre weiterführend zu erörtern, ob und wie die neun Kodizes, die im Codex Amiatinus (f. 4r) abgebildet sind,11 sowie die bei Cassiodor (inst. 1, praef. 8) belegten neun Kodizes mit den von Trobisch postulierten Sammlungseinheiten in Zusammenhang stehen. Cassiodor hatte die gesamte Bibel in (vermutlich alt-)lateinischer Übersetzung12 und in Form von neun Kodizes vorliegen,13 wobei der achte Kodex die „kanonischen Briefe der Apostel“ – vermutlich in der Reihenfolge Paulusbriefe, katholische Briefe – (inst. 1,7,1) und der neunte Kodex die Apostelgeschichte und die Apokalypse (inst. 1,8,1) enthielt. Ein redaktionelles Interesse für diese Zusammenstellung (aus der Sicht Trobischs müsste man sagen: Neuzusammenstellung) liegt in der mutmaßlichen Zusammenfassung nach gattungsmäßigen Kriterien (Briefe vs. Erzähltexte im weitesten Sinne). Cassiodor nimmt aber die Paulusbriefe trotz Zusammenstellung mit den anderen Briefen als eine Einheit wahr; zudem stehen die Katholische Briefe am Ende von Kodex 8 und die Apg am Anfang von Kodex 9 noch in einer gewissen Nähe.14
Für eine Entscheidung vor dem technischen Hintergrund der antiken Buchproduktion besteht für das 2. Jh. ein dramatisches Quellenproblem, das mit der zeitlichen und regionalen Verteilung des handschriftlichen Befundes zusammenhängt: Wir besitzen aus dem 2. Jh. einfach keine materiellen Zeugnisse aus den geographischen Räumen (Kleinasien und Italien), die für eine von Trobisch postulierte Edition in Frage kämen. Den dünnen papyrologischen Befund aus dem provinziellen ägyptischen Hinterland für die technische Frage der frühchristlichen Buchproduktion im 2. Jh. auszuwerten – das gängige Vorgehen –, ist aus meiner Sicht methodisch nicht unproblematisch. Die auf dieser Basis gewonnene Evidenz kann die Beweislast eines validen Gegenarguments nicht tragen, umgekehrt ist aber auch der Beweis einer Existenz von einem Kodex, der das gesamte NT schon im 2. Jh. enthielt, nicht möglich.15
Chr. Markschies weist bei seiner Untersuchung von Bibliotheksinventaren darauf hin, dass „ein vollständiges Neues Testament dagegen häufiger aufzutreten“16 scheint und führt dazu fünf bzw. sechs Bibliotheksinventare an. Die Auswertung des Befundes von Papyri, Ostraka und Inschriften müsste jedoch m. E. im Einzelnen noch einmal diskutiert werden. Wie sicher ist es z. B., dass, wie Markschies vermutet, die Bezeichnung „Apostolos“ wie bei den Lektionaren17 stets die Sammlung der Paulusbriefe und die Sammlungseinheit des „[Prax]apostolos“ (= Apg und Katholische Briefe18) umfasst?19 Besteht hier nicht die Gefahr, Quellensprache und in der Textkritik historisch gewachsene Metasprache zur Bezeichnung der Sammlungseinheiten (e a p r) unsauber zu trennen? Das Ostrakon Till Nr. 148 (KO 679; Crum, Short Texts, 41, Nr. 165) belegt z. B. mit der Auflistung eines „kleinen Apostolos“ (ⲟⲩϣⲏⲙ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ) und eines „kleinen [anonymen!] Evangeliums“ (ⲟⲩϣⲏⲙ ⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ̈ⲟⲛ) doch eher eine für die Marcioniten bezeugte Bibel. Die Interpretation, das „klein“ bezöge „sich wohl auf das Format der Bücher“20, scheint eher der Verlegenheit aus Ermangelung einer besseren Erklärungsmöglichkeit geschuldet. Dass ein kleiner Apostolos hier zusammen mit einem „kleinen Psalter“ genannt wird, korrespondiert mit den Angaben über einen Psalter häretischer Gruppierungen im muratorischen Fragment. Vgl. C. Mur. 81–85 (Lietzmann, Fragment, 10: arsinoi autem seu Valentini vel Miltiadis nihil in totum recipemus qui etiam novum psalmorum librum Marcioni conscripserunt una cum Basilide Asianum Cataphrygum constitutorem ).
2.3 Die These Trobischs stünde im Widerspruch zu den Quellen (z. B. Irenäus, Canon Muratori, Origenes, Euseb), die eine Diskussion über die kanonische Geltung neutestamentlicher Schriften belegten.1
Diesem Kritikpunkt muss man zugutehalten, dass der Canon Muratori tatsächlich nicht die von Trobisch postulierte Zusammenstellung von 27 neutestamentlichen Schriften in vier Sammlungseinheiten belegt. Die diesem zudem noch schwer datierbaren und in seinem Zustand wenig vertrauenswürdigen Text zugemutete Beweislast in einigen Entwürfen zur Geschichte des neutestamentlichen Kanons ist allerdings ebenfalls diskutabel.2 Die These Trobischs ist auf der Grundlage der traditionell für die Kanonfrage ausgewerteten Quellen nicht so einfach zu falsifizieren. Vielmehr ist doch Trobischs Argument einigermaßen plausibel, die in den Quellen ablesbare Diskussion über die Zugehörigkeit einzelner Schriften zum „Kanon“ als „historisch-kritische Reflexionen über eine bereits bestehende Publikation“3 zu interpretieren. Gerade die Konstanz dieser Diskussion und ihre Fortsetzung über einen vermeintlichen „Abschluss des Kanons“ im 4. Jh. hinaus4 lässt das Modell Trobischs, das mit der Herausgabe von Sammlungen operiert und über den „kanonischen“ Status keine Aussage macht, plausibler erscheinen als die These, die „kanonische“ Zusammenstellung der 27 neutestamentlichen Schriften sei im Rahmen eines Identitätsfindungs- und Aushandlungsprozesses erst im 4. Jh. (zumindest vorläufig) abgeschlossen worden.5 Methodologische Schwierigkeiten bereitet zudem der weit verbreitete Ansatz, den Stand des „Kanonisierungsprozesses“ über die Zitation bzw. Nicht-Zitation einzelner neutestamentlicher Schriften in den Schriften der Alten Kirche zu bestimmen.6 Die so gewonnenen Ergebnisse basieren grundsätzlich auf einem argumentum e silentio .
Читать дальше
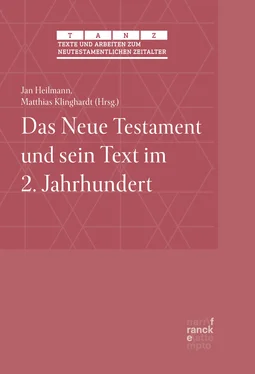

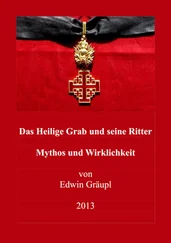
![Felix Sobotta - Das alte Jagdschloss und das neue Haus [Band 1]](/books/493473/felix-sobotta-das-alte-jagdschloss-und-das-neue-ha-thumb.webp)