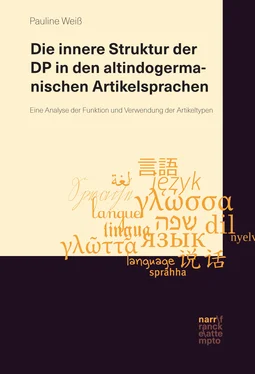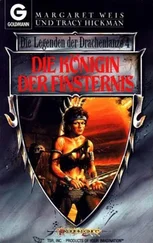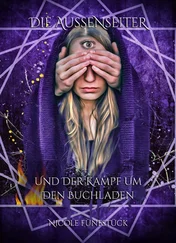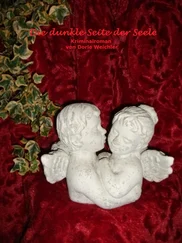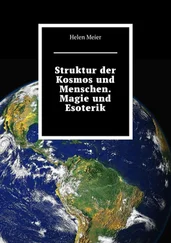Ein weiterer, entscheidender Grund, warum das Werk des Agantʿangeɫos nicht zu Lebzeiten des Königs entstanden sein kann, ist folgender: In der Forschung bestehen zwar Unsicherheiten hinsichtlich der Lebensdaten Trdats12, aber seine Konversion wird relativ sicher auf 314 datiert, nach armenischer historischer Tradition auf 301. Das armenische Alphabet wurde jedoch erst zu Beginn des 5. Jh.s entwickelt. Des Weiteren gilt die armenische Fassung als Original und man weiß, dass die Armenier vor der Entwicklung ihres eigenen Alphabets ihre Sprache nicht anhand eines anderen verschriftlicht haben. Thomson (1976) schreibt über das Werk des Agantʿangeɫos in der Einleitung, dass es eine Mischung aus erinnerter Tradition und erfundener Legende ist.
Von der Geschichte Armeniens gab es eine ältere und eine jüngere Version.13 Bewahrt ist lediglich die ältere. Die jüngere Fassung ist zwar verloren gegangen, aber durch Übersetzungen ins Griechische, Syrische, Arabische und Georgischebekannt. Der verlorengegangene Text wird Zyklus V genannt, der erhaltene Zyklus A. Kettenhofen (1995) weist zusätzlich daraufhin, dass van Esbroeck eine weitere Version gefunden hat, „… die sowohl die A- als auch die V-Rezension aneinander anglich; auch ihre armenische Vorlage ist verloren. …“14 Schon in der Antike wurde die Geschichte Armeniens von Agantʿangeɫos vielfach übersetzt.
Laut Thomson (1976) gibt es nur eine komplette Übersetzung in eine moderne Sprache. Es ist eine Übersetzung ins Italienische im Jahre 1843 durch die venezianischen Mechitaristen.15 Mit Thomsons Edition (1976) liegt die erste englische Übersetzung vor. Diese wurde grundlegend für die vorliegende Arbeit genutzt.
I.3.4.2 Historische Hintergrundinformationen
Die Geschichte Armeniens von Agantʿangeɫos beschreibt die armenische Geschichte des 3. Jh. Zu dieser Zeit gab es zwei Großmächte, die Römer im Westen und die Parther im Osten. Beide unterhielten friedliche Beziehungen und teilten den gleichen Feind, i.e. die erstarkenden Perser. Diese versuchten derzeit die Parther im Osten zu verdrängen. Agantʿangeɫos berichtet zunächst über die Sasanidische Revolution des Jahres 224. Die Parther, die lange Zeit im Iran herrschten, wurden abgesetzt und die Perser nahmen deren Position ein. Dies beschwor einen Konflikt mit den Armeniern herauf, deren amtierender König Khosrov der Linie der Parther entstammte. Der zu den Persern übergelaufene Fürst Anak ermordete König Khosrov. Im Gegenzug wurde Rache an Anak und seiner Familie geübt, lediglich sein Sohn Gregor überlebte. Er wurde in Kappadokien bei einer Christin im christlichen Sinne erzogen. Später wird er als Gregor der Erleuchter, der Apostel der Armenier, bekannt werden. Auch der Sohn Khosrovs, Trdat III. oder Trdat IV.1, wurde außer Landes gebracht. Durch römischen2 Einfluss erhielt Trdat unter der Herrschaft des römischen Kaisers Diocletian den armenischen Thron zurück. Die römische Politik beeinflusste die armenische entscheidend. Kaiser Diocletian verfolgte Christen und ebenso wurden Christen in Armenien verfolgt und umgebracht. Doch als sich in Rom unter Kaiser Konstantin die Haltung gegenüber den Christen änderte, änderte auch König Trdat seinen Kurs. Diese Problematik ist mit einer Legende3 verknüpft, die von der Ermordung 33 nach Armenien geflüchteter Jungfrauen handelt. Angeblich hat es sich folgendermaßen zugetragen: König Trdat verliebte sich in die schöne Nonne Hripʿsimeankʿ. Er begehrte sie zur Frau, doch sie wollte keinen „Heiden“ ehelichen. Daraufhin ließ der König Hripʿsimeankʿ sowie weitere Jungfrauen aus ihrem Orden ermorden. Damit nahm, der Geschichte nach, die Christenverfolgung in Armenien ihren Lauf. Trdat aber wurde sehr krank und verwandelte sich in ein Wildschwein. Seine Schwester Khosroviducht hatte eine Vision, dass nur Gregor, der Sohn des Anak, ihn retten könnte. Gregor befand sich zu dieser Zeit bereits seit einiger Zeit im Kerker, weil er als Christ erkannt worden war. Nun wurde er herausgeholt, bekehrte und heilte den König und das Christentum hielt als anerkannte Religion Einzug in Armenien. Wie viel Wahrheit in dieser Legende steckt, kann man heute nicht mehr genau sagen. Interessant sind aber zwei Dinge: Zunächst wird mit der Bekehrung des armenischen Königs direkt ein christliches Grundprinzip demonstriert, i.e. das Vergeben. Trdat und Gregor sind eigentlich aufgrund ihrer Herkunftsverhältnisse Feinde, doch durch die Heilung und Bekehrung überwinden sie dies. Gregor wird danach geistliches Oberhaupt Armeniens. Somit arbeiten Gregor und Trdat Hand in Hand. Hinsichtlich der Wahrheit ist bei Deschner (1996) zu lesen, dass Gregor um 280 das Christentum verkündete und „… [d]abei gewann er Einfluß auf König Trdats Schwester Chosroviducht und zuletzt auf den König …“.4 Der zweite interessante Punkt ist die neue Religion. Armenien war lange Zeit geteilt, so dass ein Teil des Landes iranisch und der andere griechisch geprägt war. Das Volk besaß also keine einheitliche Religion. Durch die Einführung des Christentums als Staatsreligion wird das Volk auch im Geiste geeint. Zugleich wurde dadurch politisch eine neue Zeit eingeleitet. Eine andere Meinung vertritt Deschner (1996). Er sieht den Übertritt der Armenier zur christlichen Religion in der Feindschaft mit den Persern begründet. Er schreibt: „… Das Motiv für den Übertritt des Königs und damit für die Christianisierung des Volkes war nichts andres als der Argwohn, die Feindschaft gegen Persien. …“5 So hat das armenische Volk die neue Religion nicht aus eigenem Entschluss angenommen. Vielmehr befahl König Trdat dem Volk Christen zu werden, wie er auch. Im Zuge dessen wurde Armenien das erste Land, das das Christentum als Staatsreligion eingeführt hat.
I.4 Theoretische Grundlagen
In diesem Kapitel werden die zugrunde gelegten Theorien erläutert, die anschließend in Kapitel II und III angewendet werden, wobei beide Kapitel ineinander greifen sowie aufeinander aufbauen. In Kapitel II erfolgt eine Beschreibung und Untersuchung des Artikels nach grammatiktheoretischen Grundsätzen, die sich besonders in der finalen Analyse auf das Prinzipien- und Parameter-Framework stützen (vgl. Kap. II.10). Dieses Framework bildet auch den Ausgangspunkt der syntaktischen Analyse. Ausgehend von der Erforschung grammatischer Kategorien und Funktionen wurden innerhalb der generativen Grammatik verschiedene Hypothesen zur Erklärung von Serialisierungen und syntaktischer Besonderheiten entwickelt. Dazu gehören u.a. die Rektions- und Bindungstheorie oder die DP-Analyse1, die zur Erforschung des definiten Artikels als maßgebliche Basis dient (vgl. Kap. III). Mittels dieser Analyse können syntaktische Zusammenhänge sichtbar gemacht und somit Serialisierungen sowie unmarkierte Strukturen im Nominalbereich leichter gedeutet werden. Phänomene, wie mehrere Artikel in einer Phrase, können ebenfalls durch diesen syntaktischen Ansatz erklärt werden.
Im Folgenden werden zunächst die für diese Arbeit wichtigen Grundlagen des Prinzipien- und Parameter-Frameworks dargelegt (Kap. I.4.1), anschließend die DP-Hypothese sowie weitere Theorien, Termini und Begriffe der generativen Grammatik, die zum Verständnis der Untersuchung essentiell sind (vgl. Kap. I.4.2).
I.4.1 Zum Prinzipien- und Parameter-Framework
Das Prinzipien- und Parameter-Framework ist eine Grammatiktheorie, die auf Chomsky (1981, 1982) zurückgeht und sprachübergreifend den Aufbau von natürlichen Sprachen beschreibt.1 Nach dieser Theorie gibt es Prinzipien und Parameter, die zusammengenommen eine spezifische Sprache konstituieren. Prinzipien sind universelle Regeln, Grundsätze, Merkmale etc., die in jeder Sprache Geltung haben, d.h. es handelt sich um obligatorische Gesetzmäßigkeiten, die eine Sprache determinieren. Die Prinzipien bilden also die Grundlagen der sog. Universalgrammatik. Parameter sind demgegenüber Features, die ein sprachliches Element zusätzlich aufweisen kann und die die speziellen Besonderheiten einer Sprache formen.
Читать дальше