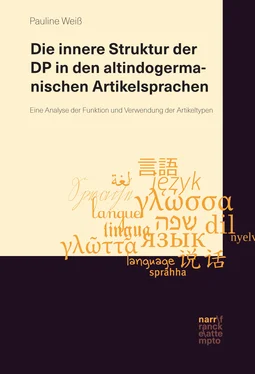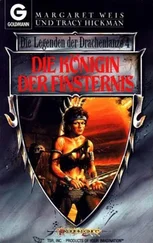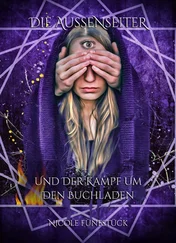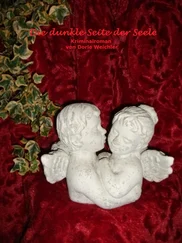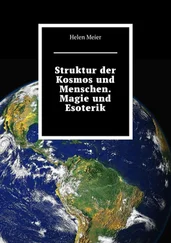I.3.2.2 Über die Dottrina cristiana von Matrënga
Die Dottrina cristiana , oder auf Albanisch Mbsuame e Krështerë , von Lekë Matrënga aus dem Jahre 1592 ist das erste bekannte Werk im toskischen Dialekt. Gedruckt wurde es in Rom. Es handelt sich hierbei um eine Übersetzung des Katechismus des Jesuiten Jacob Ledesma. Als Vorlage diente eine italienische Version, mit der die Dottrina cristiana verflochten ist. So wechseln sich italienische und albanische Passagen ab. In der vorliegenden Untersuchung wird der italienische Part nicht berücksichtigt, da er gleichen Inhalts wie der albanische Text ist und die vorliegende Untersuchung das Italienische nicht einbezieht. Gemäß der Vorlage ist die Dottrina cristiana als Frage-Antwort-Text gestaltet. Dabei werden Inhalte des christlichen Glaubens dargelegt, verschiedene Gebete vorgetragen und besprochen sowie Dogmen erklärt. Zusätzlich enthält das Buch eine Einleitung in zeitgenössischer italienischer Sprache. Eine Besonderheit der Dottrina cristiana ist, dass sie mit einem kurzen Gedicht, dem Canzone Spirituale , beginnt, der ersten niedergeschriebenen albanischen Lyrik.
Das Werk Matrëngas umfasst 48 Folioblätter. Es sind drei verschiedene Handschriften der Dottrina cristiana erhalten. Man geht sogar davon aus, dass eins dieser Manuskripte die Handschrift Matrëngas selbst ist. Als gedrucktes Buch ist die Dottrina cristiana nur in einem Exemplar erhalten.
Matzinger (2006) informiert über das Buch:
„… Da die gedruckte Ausgabe allerdings sehr fehlerhaft und insgesamt recht mangelhaft war, ist es dieser schlechten Qualität zuzuschreiben, daß der Druck keine große Resonanz gefunden hat. So ist die Dottrina cristiana des Lekë Matrënga in der Folge in Vergessenheit geraten. …“1
Über Matrënga selbst ist ein wenig mehr als über Buzuku bekannt. Matrënga lebte von 1567–1619. Über seinen Geburtsort besteht Ungewissheit. In Frage kommen Piana dei Greci2 oder Monreale, beide Orte liegen in der Provinz Palermo auf Sizilien. Matrënga stammt aus einer toskischen Familie, die vermutlich 1532/33 aus Albanien ausgewandert ist. 1582–1587 studierte Matrënga in Rom am griechischen Kollegium des Heiligen Athanasius und kehrte anschließend nach Sizilien zurück. Die Weihe zum Priester erhielt er vermutlich 1591. Über seine späten Lebensjahre weiß man, dass er in der italoalbanischen Gemeinde in Piana dei Greci als Geistlicher wirkte. Dort starb er auch am 6. Mai 1619 als Erzpriester. Im Unterschied zu Buzuku war Matrënga ein Geistlicher orthodoxen Glaubens.
I.3.3 Zur Hrafnkels saga freysgoða
Der altnordische Text Hrafnkels saga freysgoða 1 ist eine fiktive Erzählung, die in das Genre Saga einzuordnen ist. Sie lebt besonders von Rachemotiven, die einen Gerichtsprozess führen. Die Geschichte berichtet, wie es zu diesem kam, aber auch auf welche Weise die Figuren streiten und welches Ende der Konflikt nimmt. Der Rechtsstreit wird beinah demokratisch gelöst, was für die Zeit, in der die Geschichte spielt, durchaus bemerkenswert ist.
Die Hauptprotagonisten der Saga Hrafnkels saga freysgoða sind Hrafnkell und Sámr, wobei Sámr erst etwa in der Mitte der Geschichte auftritt. Zu Beginn der Saga werden Hrafnkell und sein Wohnsitz, der Adelhof, beschrieben. Hrafnkell ist ein wohlhabender und mächtiger Mann, der das Godenamt ausübt, d.h. er erfüllt eine gewisse Schutzfunktion und Gerichtsbarkeit. Ein armer Mann, Þorbjǫrn, schickt seinen ältesten Sohn Einar in den Dienst Hrafnkells, wo er eine Anstellung als Schafhirte erhält. Eines Tages jedoch verschwinden die Schafe. Um sie schneller finden und zurücktreiben zu können, fängt Einar von einer Pferdeherde eins der Tiere ein. Er erwischt den Hengst Freyfaxi, der Hrafnkell gehört und dem Gott Freyr geweiht ist. Hrafnkell hat es jedermann untersagt, ihn zu reiten. Natürlich hofft Einar, dass Hrafnkell nichts bemerkt. Doch Hrafnkell erfährt davon und erschlägt Einar. Der Vater Einars verlangt Vergeltung und fordert ein Rechtsurteil. Þorbjǫrn sucht hinsichtlich des Streits Unterstützung bei seinem Bruder Bjarni und dessen Sohn Sámr, der im Laufe der Geschichte als Gegenspieler Hrafnkells hervortritt. Sámr übernimmt die Klage für Einars Vater. Daraufhin wird ein Thing einberufen und der Prozess zu Gunsten Þorbjǫrns und Sámrs entschieden. Hrafnkell wird als friedlos erklärt und von seinem Hof vertrieben. Stattdessen bezieht Sámr diesen mit seinen Leuten, auch den Hengst Freyfaxi nimmt er in Besitz. Allerdings wird das Pferd getötet, da überhaupt erst der Ritt auf ihm den Streit heraufbeschworen hat. Hrafnkell verlegt seine Wirtschaft und erarbeitet sich erneut Reichtum und Ansehen. Zum Ende der Saga kehrt der Bruder Sámrs, der Seemann Eyvindr, nach Island zurück. Als dieser mit seinen Leuten von der Küste in das Landesinnere reitet, treffen sie mit Hrafnkell und einigen von dessen kampftüchtigen Untergebenen zusammen. Es kommt zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, in der Hrafnkell Eyvindr tötet. Anschließend fällt Hrafnkell mit seinen Leuten auch bei Sámr ein, vertreibt ihn vom Adelhof und raubt all seinen Besitz, aber lässt ihn am Leben. Die Geschichte endet damit, wie Hrafnkell seinen Grundbesitz unter sich und seinen Söhnen aufteilt und viel später an einer Krankheit stirbt.
Der Rechtsstreit sowie die anschließende Enteignung und Vertreibung Hrafnkells bilden den längsten Part der Geschichte. Der Totschlag Einars ist die Vorgeschichte, die den Streit heraufbeschwört. Mit dem Tod Eyvindrs kommt es im Verlauf der Erzählung erneut zu einem Konflikt. Das Ende der Saga ist die Rache Hrafnkells. Die Saga kann in die Abschnitte Einleitung, erster Konflikt, erste Rache, beruhigte Phase, erneuter Konflikt, zweite Rache und Ende gegliedert werden. Dies spiegelt das Grundschema wieder, nach dem die Isländersagas aufgebaut sind.
Der Terminus Saga (anord. saga ‚etwas Erzähltes‘) ist von anord. segja ‚sagen, erzählen‘ abgeleitet und bedeutet ‚Mitteilung, Bericht‘. Sagas gehören zur altnordischen Prosaliteratur und sind in schriftlicher Form überliefert. Sie werden in der Forschung in verschiedene Untergruppen eingeteilt, so spricht man beispielsweise von den Königssagas, den Bischofssagas, den Isländersagas, den Vorzeitsagas und anderen.2 Gegenstand der folgenden Darstellung sind ausschließlich die Isländersagas, da die Hrafnkels saga freysgoða zu diesen gehört. Insgesamt sind etwa 40 Geschichten dieser Art überliefert. Die Bezeichnung Isländersaga, bzw. auf Isländisch Íslendinga sögur , leitet sich von der Herkunft der Protagonisten ab, „… die zu den ersten Generationen des isländischen Volkes gehörten, von der Landnahme bis etwa 1030. …“3 Die überlieferten Sagas entstammen der Zeit zwischen der Mitte des 12. Jh. bis ins 14. Jh. Die Autoren sind häufig nicht bekannt. Ebenso ist oft unklar, wann genau und wo die einzelnen Sagas verfasst wurden. Auch hinsichtlich möglicher Quellen können nur Vermutungen angestellt werden. Es ist anzunehmen, dass die Sagas ein Potpourri mündlicher Überlieferungen, älterer Schriften, Genealogien und der Phantasie des jeweiligen Autors darstellen. Eines sind sie jedenfalls nicht: zuverlässige historische Quellen für die Zeit von etwa 930–1030. Die Sagas zeigen vielmehr, welche Vorstellung ihre Verfasser von der Zeit um das 10. Jh. gehabt haben mögen. Thematisch drehen sich die Isländersagas stets um Auseinandersetzungen, Kämpfe, Fehden und Rache. Dabei werden die Charaktere sehr plastisch und lebendig dargestellt. Sie haben sowohl gute wie schlechte Seiten und erleben im Laufe der Erzählung einen Wandel. Baetke (1952) rühmt die Sagaliteratur mit folgenden Worten:
„… Diese Literatur erweckt das Interesse des Literaturhistorikers schon deswegen, weil es die einzige künstlerische Prosaliteratur des abendländischen Mittelalters ist mit einem ebenfalls einzigartigen Sprachstil und einer realistischen Darstellungsform, die erst in der Neuzeit ihresgleichen gefunden hat. …“4
Читать дальше