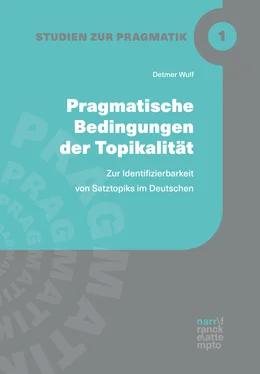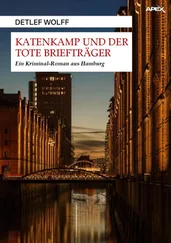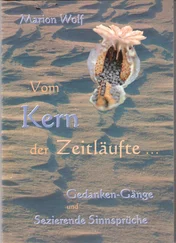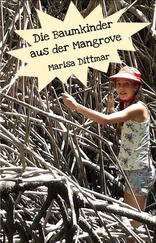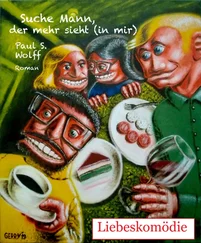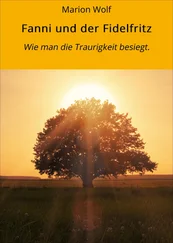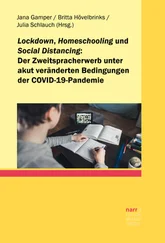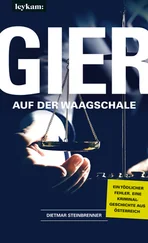Die Kennzeichnung der Satzelemente im Hinblick auf ihren kommunikativen Status als alte bzw. neue Information durch ihre Stellung im Satz – für Weil ein hervorstechendes Merkmal der klassischen Sprachen – demonstriert er anhand von Beispielen aus dem Lateinischen, in dessen freier Wortstellung er die funktionale Differenzierung zwischen „mouvement objectif“ und „mouvement subjectif“ deutlich ausgeprägt sieht (vgl. ebd., 20f.). Wortstellungsvarianten wie beispielsweise Romulus condidit Romam und condidit Romam Romulus , die hinsichtlich ihrer syntaktischen Relationen identisch sind – beide benennen ‚objektiv‘ denselben Sachverhalt – sind ‚subjektiv‘ auf verschiedene Kommunikationskontexte zu beziehen, in denen jeweils anderes als bekannt vorausgesetzt ist. Weil deutet die erste Variante als Aussage über die Person Romulus, wobei die satzinitiale Stellung das Subjekt als bekannt auszeichnet, und die zweite Variante Auskunft darüber, wer Gründer der Stadt Rom ist, sodass das Subjekt als Träger der neuen Information an den Schluss des Satzes rückt.
Weils Ansatz, zusätzlich zur Ebene der syntaktischen Relationen eine zweite, kommunikativ orientierte Ebene anzunehmen, ist von späteren Autoren aufgegriffen, jedoch in unterschiedlicher Weise inhaltlich bestimmt worden. Während sich Weil in seiner funktionalen Unterscheidung zwischen objektiver und subjektiver Ebene noch an einzelsprachlichen Strukturmerkmalen orientiert1 – die Beziehung der Satzglieder zueinander wird morphologisch, ihre Beziehung zur Äußerungssituation über die Wortstellung markiert – erhält die Interpretation des von Weil so genannten „mouvement subjectif“ bei Georg v.d. Gabelentz (1891) eine von der sprachlichen Ebene losgelöste, psychologische Interpretation.2 V. d. Gabelentz analysiert die Struktur von Sätzen bzw. Äußerungen auch hinsichtlich ihres Informationsstatus, wobei er seine Bestimmung informationsstruktureller Kategorien an den Bedingungen der Informationsübermittlung festmacht.
Wie lässt sich nun der Informationsstatus der einzelnen Redebestandteile bestimmen? V. d. Gabelentz nimmt hierfür eine adressatenorientierte Perspektive ein. Ziel einer Äußerung ist es nämlich, das eigene Vorstellungsbild in gleicher Form beim Hörer zu erzeugen. Diesen Vorgang vergleicht v.d. Gabelentz mit dem Beschreiben eines Papierstreifens in einem Telegraphenapparat, wobei die beschriebene Rolle „immer stärker anschwillt“ und der Papierstreifen „der noch vollgeschrieben werden soll […], zur anderen Rolle hinübergleitet“ (v.d. Gabelentz 1891, 369). Der Sprecher kennt den gesamten Vorstellungsinhalt, in der vom Autor gewählten Metapher also den beschriebenen sowie den unbeschrieben Teil des Papierstreifens; der Hörer muss die Vorstellung im Verlauf der Äußerung erst noch vervollständigen. Einen solchen Akkumulationsprozess stellt sich v.d. Gabelentz als durchaus sprechergelenkt vor. Der Sprecher „leitet […] mit dem ersten Worte des Anderen Denken auf eine gewisse Vorstellung und dann weiter und immer weiter, immer neue Erwartungen jetzt weckend, jetzt, gleich darauf, befriedigend“ (ebd., 369).
V. d. Gabelentz’ Pointe ist es nun, den Zusammenhang zwischen schon Gehörtem und Erwartetem im Verlauf der Äußerung in Analogie zu den grammatischen Kategorien Subjekt und Prädikat zu bestimmen: Ich nenne zuerst dasjenige, „was mein Denken anregt, mein psychologisches Subject, und dann das, was ich darüber denke, mein psychologisches Prädicat“ (ebd., 369f.). Das, worüber man etwas mitteilt und das, was man darüber mitteilt, also psychologisches Subjekt bzw. Prädikat, kann den jeweiligen grammatischen Kategorien entsprechen, es kann aber auch ganz anderen grammatischen Einheiten zugeordnet sein, wie v.d. Gabelentz anhand zahlreicher Beispiele demonstriert (vgl. 370f.). So lässt sich etwa in einem Satz wie
| (1) |
Gestern war mein Geburtstag. |
die adverbiale Bestimmung gestern unter bestimmten Bedingungen als psychologisches Subjekt auffassen, nämlich dann, wenn „ich von einem gewissen Tage [rede] und […] von ihm aus[sage], dass er mein Geburtstag war“ (ebd., 370). Und in einem Sprichwort wie
| (2) |
Mit Speck fängt man Mäuse. |
übernimmt die satzinitiale Adverbialbestimmung ( mit Speck ) die Rolle des psychologischen Subjekts, denn, so v.d. Gabelentz, nicht vom grammatischen Subjekt man sei hier die Rede, sondern das Mittel (der Speck) bilde den Gegenstand der Äußerung, von dem dann ausgesagt werde, was man damit macht, nämlich Mäuse zu fangen (vgl. ebd., 370).
Im Rahmen seiner Ausführungen zur Funktion der Intonation beschreibt v.d. Gabelentz des Weiteren Phänomene, die in heutiger Terminologie als Fokus- oder Kontrastakzent bezeichnet werden:
Was wir für’s Ohr betonen, für’s Auge unterstreichen oder typographisch auszeichnen lassen, ist also dasjenige, worauf es uns besonders ankommt, was uns das wichtigste ist. Wichtig ist es uns in Rücksicht auf einen vorhandenen oder vorgesetzten Gegensatz. (373)
Hier kommt v.d. Gabelentz einer adressatenorientierten Perspektive recht nahe; einen systematischen Zusammenhang zu seinem Verständnis der psychologischen Subjekts- bzw. Prädikatsebene stellt er jedoch nicht her. Explizit weist er diese Kategorienebene der Wortstellung zu:
Nicht die Betonung, sondern die psychologischen Subjects- und Prädicatsverhältnisse entscheiden über die bevorzugte Stellung der Satzglieder, und das seelische Verhalten, das sich in der Betonung äussert, hat mit jenem Verhältnisse nichts zu thun. (376)
Das, worüber gesprochen werden soll, ist im Verlauf der Äußerung des Satzes zuerst zu nennen. Was darüber ausgesagt wird, muss dann daran angeschlossen werden.3 Mit seiner Metapher vom Telegraphenapparat will v.d. Gabelentz verdeutlichen, dass diese Reihenfolge zwingend aus den Bedingungen der Kommunikationssituation hervorgeht, wobei er diese nicht dialogorientiert, also im Hinblick auf wechselseitige Äußerungsabfolgen zwischen zwei Gesprächsteilnehmern betrachtet, sondern unter dem Aspekt der Mitteilung von Information an einen Adressaten. Die Satzgliedstellung hat für ihn somit eine informationsstrukturierende Funktion: Sie zeigt an, welche Elemente als das ‚Worüber‘ des Satzes zu verstehen sind, unabhängig von ihren oberflächengrammatischen Relationen.
In heutige Terminologie lässt sich v.d. Gabelentz’ psychologisches Subjekt und Prädikat wohl am besten mit den Begriffen Satzgegenstand und Satzaussage übersetzen. Seine Perspektive ist zwar adressatenorientiert, sie bleibt hierbei aber wesentlich der Linearität der Äußerungsabfolge in ihrer sprachlichen Realisierung und deren Perzeption durch den Hörer verhaftet. Hieraus erklärt sich wohl seine Auffassung, dass das psychologische Subjekt dem psychologischen Prädikat immer vorauszugehen habe.
Hermann Paul (1880), der ebenfalls die Begriffe psychologisches Subjekt bzw. Prädikat verwendet,4 folgt ihm in diesem Punkt nicht, und dies hat seinen Grund vor allem darin, dass er hinsichtlich der Informationsstrukturierung von Äußerungen weitere Aspekte mit in den Blick nimmt. Seine Definition ist dabei zunächst ähnlich wie die von Georg v.d. Gabelentz von wahrnehmungspsychologischen Begriffen geleitet:
Das psychologische Subjekt ist die zuerst in dem Bewusstsein des Sprechenden, Denkenden vorhandene Vorstellungsmasse, an die sich eine zweite, das psychologische Prädikat anschliesst. Das Subjekt ist […] das Apperzipierende, das Prädikat das Apperzipierte. (Paul 1880, 124f.)
Grammatisches Subjekt und Prädikat sind aus diesen psychologischen Kategorien abgeleitet zu denken, sie „beruhen auf einem psychologischen Verhältnis“ (ebd., 124). Zwar bestimmt auch Paul den Satz als Ausdruck der „Verbindung mehrerer Vorstellungen oder Vorstellungsgruppen in der Seele des Sprechenden“ (ebd., 121) und wie bei v.d. Gabelentz ist auch für ihn der Satz „das Mittel dazu, die nämliche Verbindung der nämlichen Vorstellungen in der Seele des Hörenden zu erzeugen“ (ebd.), jedoch müssen diese nicht in jeder Redesituation vollständig ausgedrückt werden. Paul erläutert dies im Rahmen seiner Diskussion der Subjekt-Prädikat-Abfolge. Kritisch wendet er sich gegen v.d. Gabelentz’ Annahme, dass das psychologische Subjekt ausnahmslos die erste Position einnehme. Zwar gesteht er zu, dass dies in vielen Fällen zutreffe, insbesondere „bei ruhiger Erzählung oder Erörterung“ (ebd., 127), die umgekehrte Reihenfolge sei jedoch eine „nicht wegzuleugnende und nicht gar seltene Anomalie“ (ebd.). Das psychologische Subjekt
Читать дальше