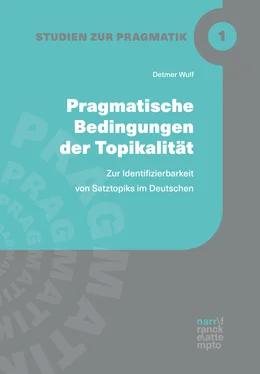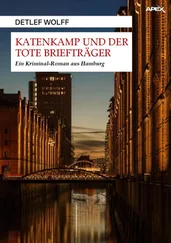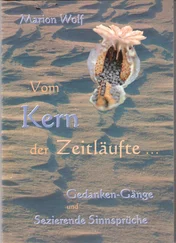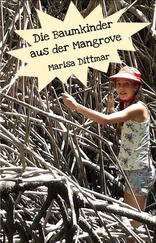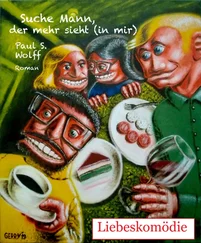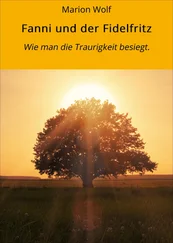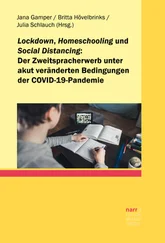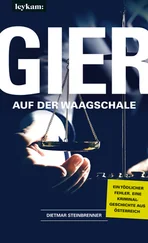Auch für das Deutsche ist die Frage nach den ausdrucksseitigen Indikatoren für Topikalität nach wie vor Gegenstand der Diskussion. So wird etwa Satzinitialität als Topik-Indikator aufgefasst (Molnár 1991; 1993; Welke 2005); es wird vermutet, dass Topiks vornehmlich durch (Agens-)Subjekte realisiert werden (von Stutterheim/Carroll 2005, Modrián-Horváth 2016); es werden bestimmte Herausstellungsstrukturen (Linksversetzungen) als Topik- oder Thema-indizierende Strukturen gedeutet (Selting 1993; Frey 2005; Endriss 2009); oder es wird die These vertreten, dass es im Mittelfeld des Deutschen eine feste Topik-Position gibt (Frey 2000; 2004). Ebenso wird aber auch auf die notorischen Schwierigkeiten hingewiesen, die insbesondere Satzabfolgen bei der Topik-Identifizierung bereiten (Cook/Bildhauer 2013).
In dieser Arbeit wird die These vertreten, dass es im Deutschen keine eindeutig ausgewiesene Position für Aboutness-Topiks gibt. Die Deutung eines Diskursreferenten als Topik (eines Satzes) beruht vielmehr auf spezifischen diskursiven (Situations-)Bedingungen, in denen der (aktuell geäußerte) Satz eingebettet ist. Ausgehend von dem pragmatischen Topik-Verständnis Lambrechts (1994) und Gundels (1988b) möchte ich der Frage nachgehen, wie diese Bedingungen genau aussehen und über welche Eigenschaften Diskursreferenten verfügen müssen, damit sie sich plausibel als Topiks deuten lassen.
In der Arbeit wird drei zentralen Fragen nachgegangen. Die erste Frage bezieht sich auf den spezifischen Charakter der Aboutness-Relation. Wodurch genau zeichnet sich diese Relation aus und wie wird sie in den unterschiedlichen Ansätzen expliziert? Die zweite Frage bezieht sich auf das für Referenten mit Topikstatus immer wieder hervorgehobene Verhältnis von Topikalität und Präsupposition. Was genau ist darunter zu verstehen, wenn man sagt, dass Topiks präsupponiert sind? Die dritte Frage ist mit der zweiten eng verwandt und zielt auf die diskursiven Bedingungen für Topikalität und auf die Eigenschaften von Diskursreferenten mit Topikstatus ab: Welche diskursiven Bedingungen müssen für die Aboutness-Relation vorausgesetzt sein und über welche Eigenschaften müssen Diskursreferenten verfügen, wenn sie Topikstatus haben? Wie sich zeigen wird, sind es Frage/Antwort-Kontexte, auf deren Basis sich die ‚Ideal‘-Bedingungen für die Identifizierbarkeit und die Eigenschaften ‚zweifelsfreier‘ Topiks am besten rekonstruieren lassen. Und wie sich des Weiteren zeigen wird, gestaltet es sich bzgl. der Identifizierbarkeit z.T. deutlich schwieriger, wenn man versucht, diese Bedingungen auf Satzabfolgen (d.h. auf Texte) zu übertragen.
Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: Das folgende Kapitel (Kap. 2) bietet zunächst einen kurzen Abriss älterer und neuerer Ansätze zur Informationsstruktur. In Kap. 3 sollen die jeweiligen Explikationsvorschläge der Autoren bezüglich des Aboutness-Begriffs vorgestellt werden. Bei der Diskussion der in manchen Punkten ähnlichen, sich im Detail aber auch deutlich unterscheidenden Ansätze soll das Hauptaugenmerk auf zwei Problemfelder gerichtet werden: zum einen auf die Frage nach dem Verhältnis von Topikalität und ‚Givenness‘, zum anderen auf die Frage, wie sich die Topik-Kategorie zur Fokus-Kategorie verhält. Ist die Fokus-Kategorie ebenfalls auf Diskursreferenten zu beziehen? Es wird sich zeigen, dass es Lambrechts Ansatz am besten gelingt, diese Problemfelder zufriedenstellend in den Griff zu bekommen. Wie wir sehen werden, zeichnet sich Lambrechts Ansatz durch zwei zentrale Merkmale aus: zum einen durch seine Unterscheidung zwischen Topik-Relation und Fokus-Relation, die beide in jeweils spezifischer Weise auf die durch den Satz ausgedrückte Proposition bezogen sind, und zum anderen durch seine Unterscheidung dreier „pragmatischer Gliederungstypen“ ( pragmatic articulations ), zu denen er neben dem Topik/Kommentar-Typ auch den Satzfokus-Typ und den sogenannten Argumentfokus-Typ zählt. Die Unterscheidung dieser drei Typen wird in der Arbeit eine wesentliche Rolle spielen.
In Kap. 4 wird das Verhältnis von Topikalität und Präsupposition genauer unter die Lupe genommen. Dieses Verhältnis wird häufig auf die (sprecherseitige) Präsupposition (adressatenseitiger) Identifizierbarkeit (Givenness) des Topik-Referenten ( Topic-Familiarity Condition , vgl. Gundel 1988a) reduziert. Zunächst soll darum noch einmal genauer gezeigt werden, dass das Vorhandensein dieser (sprecherseitigen) Voraussetzung für die Bestimmung der Topik-Relation allein nicht hinreicht. Dies ist nicht nur in Lambrechts Abgrenzung des Topik/Kommentar-Typs von den zwei anderen von ihm vorgeschlagenen Gliederungstypen reflektiert, sondern gilt auch für seine Unterscheidung zwischen pragmatic presupposition und pragmatic assertion , innerhalb der das Kriterium hörerseitigen Identifizierungswissens keine unterscheidungsrelevante Rolle spielt. Der genaue Charakter dieser allen Gliederungstypen zugrunde liegenden Unterscheidung wird diskutiert, mit besonderem Augenmerk auf den Umstand, dass Präsupposition und Assertion propositional aufzufassen sind. Zum Abschluss des Kapitels werden die präsuppositionalen Eigenschaften von Diskursreferenten mit Topikstatus genauer bestimmt, deren Charakterisierung als hörerseitig „familiar“ bzw. „identifizierbar“ bei Lambrecht durch die Annahme weiterer Präsuppositionen (Bewusstseinspräsupposition, Topik-Präsupposition) eine Präzisierung erfährt.
Diese präsuppositionalen Eigenschaften stellen die Basis für meine Ausformulierung der Topik-Eigenschaften in Kap. 5 dar. Den Ausgangs- und Bezugspunkt bildet hierbei die Position, dass Topik-Referenten hörerseitig vorhersehbare ( predictable ) bzw. erwartbare ( expectable ) und daher aktivierte, d.h. vorerwähnte „Argumente der Prädikation“ sind (Lambrecht/Michaelis 1998). Letzteres, nämlich die Position, dass Topiks als „Argumente der Prädikation“ aufzufassen sind, findet sich auch in Ansätzen, die, wie ich zeigen werde, einen ‚weiten‘ Topik-Begriff zugrunde legen (u.a. Jacobs 2001, Erteschik-Shir 2007). Das zentrale Konzept ‚weiter‘ Topik-Ansätze ist m.E. der Adressen -Begriff (siehe etwa Jacobs 2001). Topiks stellen nach dieser Auffassung die sogenannte ‚Adresse der Prädikation‘ dar, d.h. Topik ist derjenige ‚Gegenstand‘, auf den die Prädikation abzielt und in Hinblick auf den der durch den Satz ausgedrückte propositionale Gehalt hinsichtlich seines Wahrheitswerts „überprüft“ ( assessed ) wird (Reinhart 1981; Erteschik-Shir 2007).
Wie gezeigt wird, unterscheiden sich Adressierungsansätze von ‚engen‘ Topik-Ansätzen (Gundel, Lambrecht) insbesondere darin, dass sie auf das Kriterium der (vorausgesetzten) Hörer- familiarity verzichten und das Spezifizitätskriterium für die Eignung eines Ausdrucks als Topik-Ausdruck für ausreichend halten. Wie ich zeigen werde, ergeben sich aus diesem Zugriff jedoch gewisse Konsequenzen für das Verständnis von Topikalität als Relation der Aboutness, dem auch ‚weite‘ Topik-Ansätze grundsätzlich verhaftet bleiben. Eine Konsequenz ist, dass mit der Beschränkung der Aboutness-Relation auf die, wie ich es nennen werde, semantische Ebene der Prädikation die Unterscheidbarkeit der drei Lambrecht’schen Gliederungstypen (Topik/Kommentar, Argumentfokus, Satzfokus) hinfällig wird. Die wesentliche Konsequenz der Gleichsetzung von Topikalität und Adressierung besteht jedoch darin, dass es so nicht gelingt, die Topik- (bzw. Aboutness-)Relation auf der Basis der pragmatischen Unterscheidung von Präsupposition und Assertion zu explizieren. So können etwa Prädikationsadressen auch zur Assertion gehören, was in bestimmten Argumentfokus-Kontexten der Fall ist. Würde man einen solchen Zusammenfall von Topik und Fokus zulassen, so wäre damit in der Konsequenz aber auch die Herleitung der Aboutness-Relation aus der Unterscheidung von Präsupposition und Assertion (und ebenso ihr Verständnis als Spezialfall dieser Unterscheidung) hinfällig. Zwar möchte ich das Adressenkonzept für die Charakterisierung von Topiks übernehmen, jedoch mit der Einschränkung versehen, dass Topiks zwar immer die Adresse der Prädikation bilden, aber Prädikationsadressen nicht notwendig Topikstatus haben müssen. Den Status von Topiks als Adressen und ‚centers of current interest‘ (Strawson) möchte ich über den Begriff der diskursiven Salienz fassen. Anhand einer Reihe von (konstruierten) Beispielen werde ich zeigen, auf welche Faktoren die Salienz eines Referenten zurückgeführt werden kann. So ist die Salienz eines Referenten nicht nur durch seine adressatenseitige Zugänglichkeit, sondern auch durch bestimmte diskursive Aspekte bedingt. Auf der Basis dieser Faktoren lassen sich Topiks dann als Adressen charakterisieren, die diskursiv salient, aktiviert und (somit notwendig auch) adressatenseitig zugänglich sind. Zum Abschluss des fünften Kapitels werde ich noch auf einige Konsequenzen eingehen, die sich aus der in dieser Arbeit zugrunde gelegten Position ergeben, dass Topikalität eine Status-Eigenschaft von Diskurs referenten ist.
Читать дальше