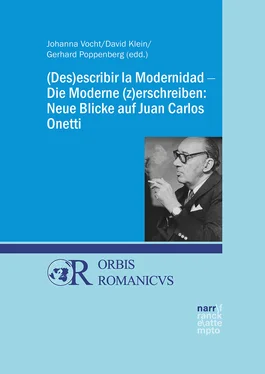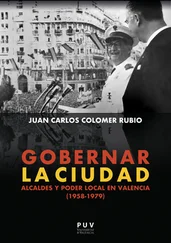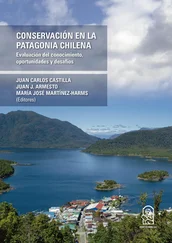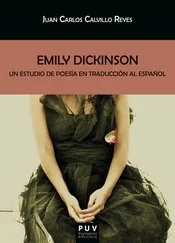Die affektive 'Katharsis' der Sanmarianer ereignet sich dann im sechsten und letzten Teil der Erzählung, wo zunächst die freudlose Kleinbürgerlichkeit der "[…] pobladores antiguos" (ibid., cap. 6, 147) von Santa María zur Sprache gebracht wird:
A pesar de los años, de las modas y de la demografía, los habitantes de la ciudad continuaban siendo los mismos. Tímidos y engreídos, obligados a juzgar para ayudarse, juzgando siempre por envidia o miedo. (Lo importante a decir de esta gente es que está desprovista de espontaneidad y de alegría; que sólo puede producir amigos tibios, borrachos inamistosos, mujeres que persiguen la seguridad y son idénticas e intercambiables como mellizas, hombres estafados y solitarios. Hablo de los sanmarianos; tal vez los viajeros hayan comprobado que la fraternidad humana es, en las coincidencias miserables, una verdad asombrosa y decepcionante). (Ibid., 147 sq.)
Um ( Vor ver-)Urteilen und Mutmaßen zu können, sind die Einheimischen also auf fremden Input angewiesen, "por la simple necesidad de que pasen cosas" (ibid., 150). Im Falle der zwei "desterrados de Santa María […]" (ibid., 147), die in der Heterotopie7 Las Casuarinas unterkommen, löst sich die gestaute Missgunst dann in Hohngelächter auf, hat doch die alte Dame, die mit dem Paar eine Art zweiten Frühling erlebt hatte (ibid., cap. 5, 145-147), den beiden am Ende 'nur' ihren diarrhöischen Hund und 500 Pesos vermacht (ibid., cap. 6, 154-156). So stellt sich der Argwohn der Kleinstädter als letztlich unbegründet heraus. Zumal, wie der Rosen-Kavalier zum Schluss beweist, die Lebemenschen mehr als Einsamkeit und Gier verband: So wird das geerbte Geld gänzlich in Grab-Rosen für die verstorbene Doña re-investiert.8
Als Fremde in Santa María nie wirklich angekommen (geschweige denn aufgenommen), muss das Kind vom Rosen-Kavalier und der "[…] enana preñada […]" (ibid., cap. 5, 147) dann in einem Außen-Raum schlechthin – dem Hafen von Santa María zur Welt kommen (ibid., cap. 6, 156).
Was Onettis Historia aus poietischer Sicht so relevant macht, ist ebendieses metafiktionale Vorführen von Stigmatisierung, durch die Fremde ver fremdet werden. So wird das von Anbeginn als 'anders' wahrgenommene, von außen nach Santa María kommende Paar von den bereits zitierten Specht-Vorwürfen gleichsam an den Rand Santa Marías gedrängt, um damit umso stärker in ein 'Fadenkreuz' von Vermutungen respektive Mutmaßungen zu geraten.1 Dass diese sich als grundlos herausstellen, tut dabei wenig zur Sache, da der restitutive Makel der beiden mehr darin bestanden zu haben scheint, sich schlicht zu wenig für die Sanmarianer interessiert zu haben. (Galant und liebenswert zu sein, reicht nun mal nicht aus, um in einer Welt aufgenommen zu werden, die von Neid und Angst erfüllt ist.)
Dabei wären der Rosen-Kavalier und die Liliput-Maid aufgrund ihrer Namensherkunft eigentlich prädestiniert dafür, um in einem metafiktional-imaginären Ambiente Fuß zu fassen. Verweist er doch auf eine bekannte Richard-Strauss-Oper, sie auf eine Provenienz aus einem berühmten Swift-Roman, inklusive einer marianischen Konnotation ( Virgen encinta ).2 Und wie in der Jacob-Erzählung erleidet Scheinbarkeit (hier in Form von Mutmaßungen) auch in der Historia eine 'Niederlage'. Der Unterschied wäre jedoch, dass das junge glückselige Paar – im Gegensatz zum kriselnden Jacob – eben kein Brausen-Imaginäres teilt, sodass beide andersfiktionale, um nicht zu sagen: 'exomediale' (Opern/Swift-Roman-)Figuren in den Heterotopien Santa Marías bleiben. Ihre Verbannung aus dem Hause Specht gegenüber des Brausen-Platzes ist dabei symptomatisch: Denn hier haben sich zwei Santa-María-Fiktionsfremde in einen selektiven Kontext begeben, der sich gegen ihre Aufnahme fictiologisch sperrt.
Die Sanmarianer beweisen hierdurch Anflüge dessen, was man in Anlehnung an den ethno-soziologischen Begriff des 'Ethnozentrismus'3 als 'Fictiozentrismus' bezeichnen könnte, der hier entsprechend eine besondere Form der Metafiktion meint, bei der die eigene Fiktion (das eigene Als-ob) als Mittelpunkt und zugleich als gegenüber anderen Fiktionen überlegen angesehen wird . Hierfür ist es nun nicht zwingend notwendig, dass dies explizit proklamiert wird; es genügte schon die (un)bewusste Annahme, bereits in der besten beziehungsweise einzig möglichen Fiktion daheim zu sein. Der Unterschied ist freilich ein feiner: Denn wer zufrieden ist mit seiner fiktionalen Welt, muss deswegen nicht gleich davon ausgehen, dass es keine bessere, geschweige denn andersmögliche geben kann und so weiter. Und doch kann generisches Selbstbewusstsein, wie schon der hehre Hektor zeigte, in fictiozentrische Überheblichkeit kippen. Dabei erinnert ein ethnozentrisches Beispiel William G. Sumners an Onettis Provinzstädter: "Amongst the most remarkable people in the world for ethnocentrism are the Seri of Lower California. They observe an attitude of suspicion and hostility to all outsiders […]".4 Argwohn und Antipathie leiten auch die Einheimischen aus Santa María bei ihrer Beobachtung des fremden Paares, insbesondere dann, als dieses in den Außenraum der Doña Mina 'vertrieben' wurde.
Und stellt sich doch die Frage: Kennen die Bewohner Santa Marías vielleicht nichts anderes als ihre Fiktion? Hierauf könnte wohl ein Díaz Grey am besten antworten, in dem ja ein Brausen 'heimisch' ist. In der Historia erfahren wir nur, dass der extradiegetisch-homodiegetische Erzähler ein Arzt sei (HCa, cap. 5, 144; cap. 6, 150-151), was die Annahme fördert, dass es sich hierbei um Díaz Grey handeln könnte. Wie sieht nun diese Erzählinstanz das aparte Paar? Die Antwort lautet: nicht viel anders als die anderen. Der Arzt ist einer von vielen und als solcher (bis auf die bereits zitierte selbstkritische Passage über die alteingesessenen Sanmarianer) fiktionskonformistisch. So sind es eher Worte des Anwalts Guiñazú, die in diesem Zusammenhang Bedeutsamkeit erlangen, wenn dieser davon spricht, dass er dem Rosen-Kavalier liebend gerne seine 50 Pesos zurückgegeben hätte, "[a] cambio de escucharlos, de saber quiénes son, de saber quiénes y cómo somos nosotros para ellos" (ibid., 153). Hier findet sich gleichsam eine 'Arznei' gegen fictiozentrisches Misstrauen: Nicht über-, sondern miteinander reden, um zu erfahren, mit wem man es eigentlich zu tun hat, woher man kommt und wo man ist. Und es ist dann auch der professionelle Fürsprecher, der für die beiden im Außenraum angesiedelten Fremden, nach dem Tod der Doña Mina, ein Santa María konformes 'Imaginarium' wähnt, das darin bestünde, aus dem Haus der verstorbenen Dame ein "museo" zu machen, "para perpetuar la memoria de doña Mina." (ibid., 152) Darum bestehe auch keine Eile mit der Testamentseröffnung, gerade weil die beiden "[…] son de esa rara gente que queda bien en cualquier parte" (ibid.). Die zwei Ortsfremden sollten demzufolge die Heterotopie Las Casuarinas musealisieren, mithilfe der zu Requisiten gewordenen Hinterlassenschaft der Doña (ibid., 152), damit Santa María so nicht mehr auf "[...] un solo héroe, Brausen el Fundador" (ibid.) beschränkt bleibe. Was sich hier ankündigt, ist in gewisser Hinsicht eine 'eudämonistische' Bereicherung Santa Marías, das mit dem Museum zu Ehren der Doña Mina nicht nur einen anderen , glückhaften Erinnerungsort erhielte, sondern damit zugleich auch seine eigene Heterotopie ausstellte.
Immerhin scheint sich mit dem Tod der alten Dame die Einstellung der Sanmarianer dem Paar gegenüber grundlegend geändert zu haben:
Desde entonces, después del duelo, los más discretos de nosotros, los chacareros y los comerciantes voluntariosos, y hasta las familias que descienden de la primera inmigración, empezaron a querer a la pareja sin trabas, con todas las ganas que tenían de quererla . Empezaron a ofrecerle sus casas y créditos ilimitados. Especulando con el testamento, claro , haciendo todo esto con amor. Y ellos, los bailarines, el caballero de la rosa y la virgen encinta que vino de Liliput, demuestran estar a la altura de las nuevas circunstancias, a la altura exacta de esta pleamar de cariño, indulgencia y adulaciones que alza la ciudad para atraerlos. (Ibid., 153)
Читать дальше