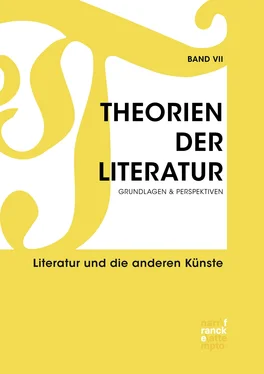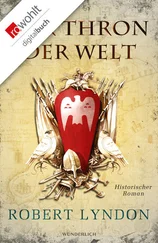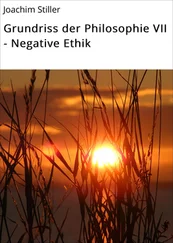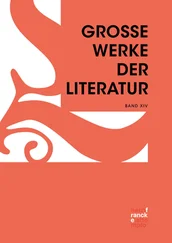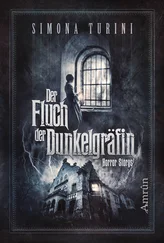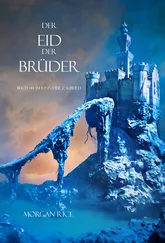1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 Harms, Wolfgang und Ulla-Britta Kuechen (Hgg.): Joachim Camerarius. Symbola et Emblemata. Naturalis historia Bibliae. Schriften zur biblischen Naturkunde des 16.–18. Jahrhunderts. Bd. 2/1, 2/2 . Graz 1986.
Harms, Wolfgang:„Historische Kontextualisierungen des illustrierten Flugblatts“. Das illustrierte Flugblatt der frühen Neuzeit. Traditionen, Wirkungen, Kontexte . Hgg. Wolfgang Harms und Michael Schilling. Stuttgart 2008. 21–62.
Harter, Ursula: Aquaria in Kunst, Literatur und Wissenschaft . Heidelberg 2014.
Haupt, Moritz (Hg.): Liber Monstrorum . Berlin 1863.
Hünemörder, Christian:„Krokodil“. Lexikon des Mittelalters . Bd. V: Hiera-Mittel bis Lukanien . München/Zürich 1991. Sp. 1542.
Koschatzky, Walter: Die Kunst der Graphik. Technik, Geschichte, Meisterwerke . München 1975.
Maurer, Emil: Manierismus. Figura serprentinata und andere Figurenideale. Studien, Essays, Berichte . München 2001.
McLean, Matthew: The Cosmographia of Sebastian Münster. Describing the world in the Reformation . Aldershot 2007.
Müsch, Irmgard:„Albertus Sebas Naturaliensammlung und ihr Bildinventar“. Albertus Seba. Das Naturalienkabinett. Locupletissimi rerum naturalium thesauri. 1734–1765 . Hgg. Irmgard Müsch, Rainer Willmann und Jes Rust. Köln 2011. 14–22.
Neubauer-Kienzl, Barbara und Wilhlem Deuer: Renaissance in Kärnten . Klagenfurt 1996.
Owens, Susan:„‚Mit großem Fleiß, Zier und Geist‘: Maria Sibylla Merian.“ Wunderbare seltene Dinge. Die Darstellung der Natur im Zeitalter der Entdeckungen . Hg. David Attenborough. München 2008. 138–174.
Papy, Jan:„Joachim Camerarius’ Symbolorum & Emblematum Centuriae Quator. From natural sciences to moral contemplation“. Mundus emblematicus . Hgg. Karl A.E. Enenkel und Arnoud S.Q. Visser. Turnhout 2003.
Renger, Konrad und Claudia Denk (Hgg.): Flämische Malerei des Barock in der Alten Pinakothek . Museumskatalog. München 2002.
Ripa, Cesare: Iconologia . The renaissance and the gods. Bd. 21. Hg. Stephen Orgel. New York 1976.
Schmidt-Loske, Katharina: Die Tierwelt der Maria Sibylla Merian. Arten, Beschreibungen und Illustrationen . Marburg 2007.
Schneider, Norbert: Stilleben. Realität und Symbolik der Dinge. Die Stillebenmalerei der frühen Neuzeit . Köln u.a. 2009.
Seipel, Wilfried (Hg.): Die Entdeckung der Natur. Naturalien in den Kunstkammern des 16. und 17. Jahrhunderts . Ausstellungskatalog. Wien 2006.
Stiegemann, Christoph (Hg.): Wunderwerk. Göttliche Ordnung und vermessene Welt. Der Goldschmied und Kupferstecher Antonius Eisenhoit und die Hofkunst um 1600 . Ausstellungskatalog. Mainz 2003.
Timm, Frederike: Der Palästina-Pilgerbericht des Bernhard von Breidenbach und die Holzschnitte Erhard Reuwichs . Die Peregrinatio in terram sanctam (1486) als Propagandainstrument im Mantel der gelehrten Pilgerschrift. Stuttgart 2006.
Treu, Ursula (Hg.): Physiologus. Frühchristliche Tiersymbolik . Dt. von Ursula Treu. Berlin 1981.
Tripps, Johannes:„Paul de Limbourg malt einen Drachen oder: getrocknete Krokodile und Lindwürmer im geistlichen Leben der Spätgotik“. Engel, Teufel und Dämonen. Einblicke in die Geisterwelt des Mittelalters . Hgg. Hubert Herkommer, Rainer Christoph Schwinges und Marie-Claude Schöpfer Pfaffen. Basel 2006.
Weiler, Christina:„Wie das Mittelmeer nach Innsbruck kam“. Von Fischen, Vögeln und Reptilien. Meisterwerke aus den kaiserlichen Sammlungen . Ausstellungskatalog. Hg. Christina Weiler. Wien 2011.
Wettengl, Kurt (Hg.): Maria Sibylla Merian. Künstlerin und Naturforscherin . Ausstellungskatalog. Frankfurt am Main 1997.
Paragone: Bestimmungen von Literatur im Wettstreit der Künste
Stephanie Wodianka
Das italienische Wort paragone kann man mit ‚Vergleich‘ oder ‚Gegenüberstellung‘ ins Deutsche übersetzen. Jenseits seiner allgemeinen Bedeutung wird unter dem Begriff Paragone in der Kulturgeschichte ein besonderer Vergleich, eine besondere Gegenüberstellung bezeichnet: Die vergleichende Gegenüberstellung der Künste.1 Diese vergleichende Gegenüberstellung war nicht immer von gleicher kultureller Relevanz. Vielmehr gibt es Konjunkturen dieses Paragone und der Vergleich der Künste war durch verschiedene kulturelle Herausforderungslagen motiviert: Das Bedürfnis zu bestimmen, was die Künste sind, was sie jeweils im Vergleich ausmacht, ist gebunden an einen mehr oder weniger expliziten Rechtfertigungszwang eigenständiger Existenz. Dieser Rechtfertigungszwang kann verschiedene Ursachen haben, ist aber immer gebunden an kulturelle Transformationen: Transformationen von Wissenskulturen, Transformationen materieller und ökonomischer Bedingungen von Kunst, oder auch Transformationen des künstlerischen Feldes durch veränderte Medienkulturen, ‚neue Künste‘, die das Verhältnis der Künste untereinander neu verhandelbar machen. Entsprechend vielfältig sind die herangezogenen Vergleichsmomente: Die vergleichende Gegenüberstellung der Künste bedarf immer der Präzisierung, auf welche Charakteristika dieser Vergleich sich eigentlich bezieht. Der Paragone führt somit immer auch zur Frage, welche Charakteristika die eine und die andere Kunst hat, ob sie überhaupt Eigenschaften hat, die andere Künste nicht haben – ob es sie überhaupt gibt. Der Paragonediskurs ist deshalb nie einfach nur ein neutraler, gegenüberstellender Vergleich, sondern an Interesselagen gebunden: Interesselagen von Künstlern, die ihre künstlerische Identität und/oder ihre ökonomische Existenz an diese Frage gebunden sehen und an die Interesselagen von Kunst-Rezipienten, die ihre Ansprüche in die Diskussion einbringen und für ‚ihre‘ Kunst Partei ergreifen. Paragone meint deshalb als kulturgeschichtlicher Begriff mehr als nur ‚gegenüberstellender Vergleich‘, er meint ‚Wettstreit‘ der Künste.
Mit der Kunst ist es wie im Leben: Besonders herausgefordert zum Vergleich sehen wir uns mit dem, was uns ähnlich ist. Aristoteles hatte für Dichtung, Rhetorik, Bildkünste Tanz und einige Arten der Musik die Naturnachahmung zum gemeinsamen Ziel erklärt und damit die Grundlage für das Bestreben dieser Künste geschaffen, bei aller Gemeinsamkeit das je Eigene hervorzuheben. Dass Aristoteles selbst bereits die Unterschiedlichkeit der formalen Mittel der Künste bei ihrer Naturnachahmung angeführt hatte (und somit selbst sein Gleichheits-Postulat relativiert hatte), wurde vergessen. Die Frage nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden, Möglichkeiten und Grenzen von Literatur und bildender Kunst wurde besonders häufig und mit besonderem Interesse gestellt – mit dem Ziel, sich wechselseitig voneinander abzugrenzen. Das liegt daran, dass Antike, Renaissance und Barock eine prinzipielle Vergleichbarkeit von Malerei und Dichtung hinsichtlich ihrer künstlerischen Mittel und Ziele gegeben sahen, und deshalb wurde den Grenzlinien zwischen diesen beiden Künsten besonders große Aufmerksamkeit zuteil. Die Konkurrenz der Bildenden Künste zu den artes liberales (also zu Dichtung, Rhetorik und Musik), ist ein Grundmotiv antiker und mittelalterlicher Literatur. Zwei Formeln haben in diesem Kontext besonders folgenreiche Interpretationen erfahren: Die Formel ut pictura poesis erit von Horaz (es ist mit der Dichtung wie mit der Malerei), und die Rede des Simonides von Keos, der Malerei als muta poesis (stumme Dichtung) und die Dichtung als pictura loquens (sprechende Malerei) bezeichnete. Die Interpretationen dieser Formeln wendeten das Deskriptum und machten es mitunter sogar zum Präskriptum : Aus ‚Es ist mit der Poesie wie mit der Malerei‘ wurde zeitweise die Doktrin ‚Es sei mit der Malerei wie mit der Poesie.‘
Читать дальше