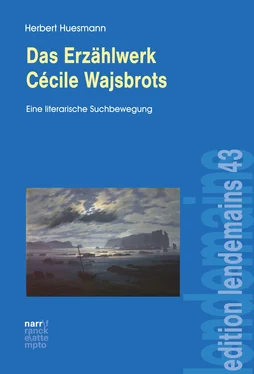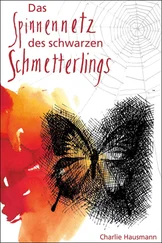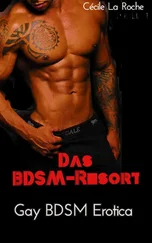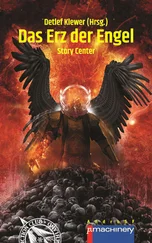Die Erzählerin erkennt zwar einen wesentlichen, von ihr als Rollenumkehr verstandenen Unterschied zwischen ihren Beziehungen zu „ihm“ und „ihr“,1 bedient sich aber bei der Beschreibung beider Verhältnisse einer stark räumlich bestimmten Bildersprache. Auffällig ist die dabei sehr früh offenbar werdende Ambivalenz ihrer Empfindungen, insofern sie sich bereits beim Anblick der ihr unbekannten „[…] familles dans les rues […]“ unwohl und ausgegrenzt fühlt: „[…] j’étais mal à l’aise, je ne voulais pas de leur vie mais je me sentais au bord du monde, en dehors de tout.“2 In ungleich stärkerem Maße setzt jedoch das intime Zusammensein mit „ihr“ in der Erzählerin widerstreitende Reaktionen frei. Um zu verdeutlichen, welch außergewöhnliche Gefühle der Genuss grenzenlos erlebter Freiheit dabei in ihr auslöst, bedient sich die Erzählerin eines ganzen Arsenals isotopisch aufeinander bezogener Metaphern, um sodann zu einer abstrahierenden Schlussfolgerung zu gelangen:
Entre les murs nous étions bien, d’une liberté sans frein, tous les rôles étaient permis, et les explorations sur les rives interdites, nous accostions, dans cette forêt nul encore n’avait pénétré, nous écartions les branches, les broussailles, marchant entre les serpents qui rampaient, fuyant notre venue, forêt de la confusion, de la perte, je me rendais compte que je n’étais pas pareille avec elle et avec les autres, parce qu’elle était femme et eux hommes, mais il y avait autre chose j’allais dire de plus profond, la transgression, ce serait peut-être plus proche, mais il y a autre chose encore, avec elle, j’oubliais quelque chose de moi, avec les autres, avec lui, j’oubliais ce que j’étais avec elle.3
Die Erzählerin beschreibt intime Begegnungen mit „ihr“ hier als Akte zügelloser Freiheit, die gleichwohl nur in der abgeschirmten Sicherheit eines geschlossenen Raumes vollzogen werden können. Wenn sie diese Akte bildhaft als gemeinsame Erkundungsreisen zu einem „verbotenen Ufer“ schildert, so erhöht sie damit unweigerlich den Reiz der Spannung, den sie noch zu steigern vermag, indem sie in ihrer Phantasie mit „ihr“ auf der anderen Uferseite einen undurchdringlich scheinenden Wald betritt und dort obendrein auf Schlangen trifft, die vor ihr und ihrer Begleiterin fliehen. Eine an dieser Stelle möglicherweise erwartete triumphierende Reaktion tritt nicht ein, vielmehr wähnt sie sich in einer „[…] forêt de la confusion, de la perte […]“. So schafft die Erzählerin mit Anklängen an eine abenteuerliche Dschungelepisode und – in stark abgewandelter Form – einer Anspielung auf die Selbsterkenntnis Adams und Evas und ihre Vertreibung aus dem Paradies im Buch Genesis sowie nicht zuletzt mit dem Topos des dunkel-undurchdringlichen Waldes4 eine Atmosphäre, in der sie die Erfahrung ihres Andersseins als „transgression“, als eine Grenzüberschreitung und darüber hinaus als ein „Sich Verlieren“ darstellen kann. Noch deutlicher formuliert sie diese Erfahrung an anderer Stelle:
[…] cherchant son corps et son désir, je ne savais plus ce qui était elle et ce qui était moi, j’ai oublié ma peur à cette dépossession, ce voyage si loin hors de mes frontières, ces secondes où j’avais quitté mon corps et mon âme pour rejoindre le sien ou flotter entre deux […]5
Die Erzählerin erlebt die intime Nähe zu „ihr“ jedoch nicht nur als eine die Grenzen ihrer eigenen Persönlichkeit aufhebende Extase, sondern zugleich als eine Form innerer Gefangenschaft:
Entre les murs, aussi, nous étions prisonnières de l’éternel recommencement, l’extrême liberté et l’extrême prison se confondaient, inéluctablement, au bout d’une semaine, d’un mois, un an, je prenais sa main ou elle prenait la mienne et après, il n’y avait plus rien à faire. Et puis au cœur de la forêt, il y avait ce territoire, abordé une fois, et depuis, jamais reconnu, quelques semaines passées, du printemps à l’été, l’extrême péril.6
So mutiert der abschirmende, Intimität ermöglichende geschlossene Raum im Laufe der Zeit zu einer Zelle, in der die Erzählerin und ihre Geliebte ihre zunächst als „extrême liberté“ erlebte und gelebte gegenseitige Hingabe als „extrême prison“, d.h. als einen äußersten Mangel an innerer Freiheit oder als eine Form von Abhängigkeit erfahren.7 Ohne dass die Entwicklung zu diesem Punkt hin restlos klar wird, verdeutlicht die in drei Nominalphrasen einmündende Syntax den dramatischen Prozess, der die Erzählerin vom vermeintlichen Gipfel des Glücks zur Einsicht in die für sie lebensbedrohende Gefährdung führt.
2.2.3 Der Äquator als virtuelles Ziel
Die zwischen „ihr“ und „ihm“ schwankende Erzählerin – […] je veux elle, je veux lui, elle pour me perdre et lui pour me sauver, ou l’inverse je ne sais pas […] – 1 glaubt, ein ideales Reiseziel gefunden zu haben, um der Kalamität ihrer Unentschiedenheit zu entkommen:
Quelque chose me guidait vers l’équateur, presque machinalement, comme les mouvements que je fais sur le ventre – sur le dos, l’effort est plus grand, les gestes moins familiers – après, on peut reconstruire, analyser, l’équateur me mettait à équidistance du pôle Nord et du pôle Sud, Quito, quitter, pour ce que je voulais quitter, il y avait l’embarras du choix. J’imaginais, davantage que les hauts-plateaux, les côtes du Pacifique, et bien sûr, l’archipel des Galapagos, malgré l’avertissement de Melville, la sinistre découpe de ses Encantadas, „royaume de la solitude“.2
Der Äquator, Ecuador und Quito – die Aussprache des Namens der Hauptstadt klingt in dem zweifachen Echo des französischen Verbs „quitter“ nach – stellen für die Erzählerin ein Ziel dar, das eine ihren „embarras du choix“ neutralisierende Wirkung ausüben könnte. Die Anspielung auf Herman Melvilles aus zehn philosophischen „Sketches“ bestehende Novelle The Encantadas or Enchanted Isles – der achte Sketch handelt von der lange Zeit auf der Norfolk Isle in völliger Isolation lebenden Mestizin Hunilla – bringt zudem die Suche der Erzählerin nach Einsamkeit und Unabhängigkeit zum Ausdruck. Dieser Eindruck scheint sich jedoch schnell zu relativieren. Wenn sie nämlich feststellt: „Au Nouveau Monde, croyais-je, disparaîtraient les questions de l’ancien“3, so verbindet sie damit durchaus auch hoffnungsvolle Gedanken an eine gemeinsame Zukunft mit der erträumten Idealfigur eines „[…] Andin au teint sombre, aux cheveux noirs, aux lèvres épaisses […]“, der ihre erotischen Phantasien auf lebhafte Weise anregt.4 In dem heruntergekommenen Ambiente des für die Einreisegenehmigung zuständigen Verwaltungsgebäudes fühlt sie sich dann jedoch wieder „[…] loin de l’Andin, à vrai dire loin de tout.“5
Nach einem sich über mehrere Tage erstreckenden Zögern beschließt die Erzählerin, nicht nach Ekuador zu reisen, ohne dies konkret zu begründen. Allerdings erfahren wir in demselben Kontext über das Verhältnis zu „ihr“, dass „[…] la distance de Paris à Quito n’était rien face à celle qu’elle instaurait entre nous“.6 So bleibt Ekuador für die Erzählerin ein Ziel, das durch seinen rein virtuellen Charakter ihre Lage als ausweglos erscheinen lässt. Die Entfremdung von „ihr“ empfindet sie daher als „[…] la chute dans le gouffre, la sensation de vide, l’arrachement physique à une chaleur douce, le rejet dans un monde froid […]“7. Mit den raum- und bewegungsbezogenen Metaphern der „chute dans le vide“ und des „rejet dans un monde froid“, aber auch der plastischen Beschreibung des „arrachement physique à une chaleur douce“ – der metonymisch gebrauchte Ausdruck „chaleur“ ist ungleich ausdrucksstärker als eine pronominale Referenz – verleiht die Erzählerin ihrem Gefühl, ausgegrenzt, verstoßen und vereinsamt zu sein, eine geradezu dramatische Intensität.
Читать дальше