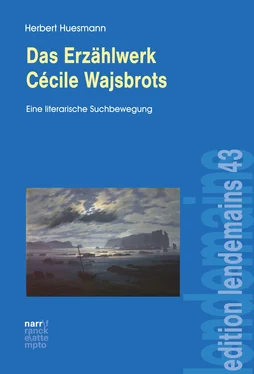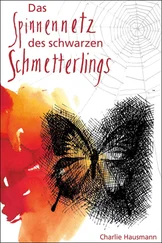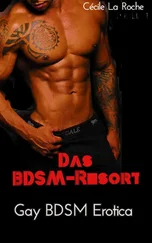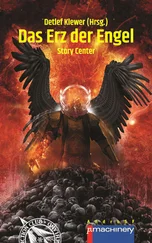2.2 Le Désir d’Équateur1 – Eine Suchbewegung „zwischen Welten“
Eine summarische Analyse der Suchbewegungen in dem 1995 erschienenen Roman Le Désir d’Équateur sollte der Frage nachgehen, ob und ggf. wie Raum und Bewegung angesichts der Verschränkung realer und virtueller Ziele und der zeitgeschichtlichen Umbrüche das Verhalten der handelnden Figur(en) beeinflussen oder aber in welcher Form die Verhaltensweise der agierenden Figur(en) durch räumliche Konstellationen oder eine räumlich geprägte Bildersprache versinn bild licht wird. Da die namenlos bleibende autodiegetische Erzählerin sich selbst in den Mittelpunkt der als Suchbewegung inszenierten Diegese rückt und alle anderen – ebenfalls namenlos bleibenden – Personen, insbesondere die Frau und der Mann, mit denen sie über einen längeren Zeitraum über eine intime Beziehung verbunden ist, nur durch ihr Verhältnis zu ihr definiert werden, ist es naheliegend, in einem perspektivierenden Rückblick die Frage der „Beweglichkeit“ auf die Erzählerin zu fokussieren.
„Je préfère aller à la piscine pour pleurer […]“1 – mit diesen Worten eröffnet die Erzählerin die Schilderung ihrer gescheiterten Beziehungen und erklärt – mit einer unüberhörbaren alliterativen Hervorhebung – das Schwimmbad zu ihrem bevorzugten Aufenthaltsort, an dem sie Trauerarbeit leistet, indem sie mit jedem Schwimmzug ihre Erinnerungen zu verdrängen versucht.2 Ihr ist sehr wohl bewusst, dass sie beim Schwimmen auf jegliche Bodenhaftung verzichtet. Beunruhigend findet sie dies jedoch nicht, vielmehr stört sie, dass sie – im Schwimmbad und andernorts – völlig unvermutet von Erinnerungen an „sie“, ihre Geliebte, heimgesucht wird.3 Gleichwohl kennzeichnet es ihre Verlorenheit und Verzweiflung, dass sie in ihrem von Krisen und Brüchen beherrschten Leben ein Schwimmbad, konkret: das Wasser als die einzige Kontinuität versprechende Umgebung betrachtet.4 Der durch das Wasser erzeugte Eindruck des Liquiden, nicht Greifbaren kennzeichnet in inhaltlicher Hinsicht die innere Instabilität, den Mangel an Beheimatung und Verortung der Erzählerin, deren Gegenwart, also die Zeit des Erzählens, überdies durch einen Eindruck der Leere und die ernüchternde mediale Wirkung des II. Golfkriegs verdunkelt wird.5 Gleichwohl generieren das Wasser, das Schwimmen und Tauchen im Verlauf des Textes eine Fülle von Bildfolgen, die eindeutig erotische Konnotationen evozieren.
Über den Wohn-, Arbeits- bzw. Aufenthaltsort ihrer bzw. ihres Geliebten teilt die Erzählerin relativ wenig mit. Um zu „ihr“ zu gelangen, fährt sie innerhalb von Paris vom Norden in den Süden und legt diese große Strecke offensichtlich hochmotiviert zurück: „Ces parcours, du nord au sud, je m’en souviens. Tout traverser, aller d’un bout à l’autre, je sais pourquoi.“6 Von „ihm“ wird „sie“ einmal in der kalten Apparateatmosphäre einer nicht lokalisierten Arztpraxis empfangen, in der sie – zunächst allein gelassen – eine „[…] tentation de partir […]“7 spürt, um unmittelbar nach seinem Erscheinen bereitwillig seinen überfallartigen sexuellen Avancen nachzugeben.8
Näher beschrieben werden die o.g. Schauplätze genauso wenig wie die sowohl mit „ihm“ als auch mit „ihr“ aufgesuchten Ziele „[…] à la mer […]“9. Dies bedeutet, dass diese Orte ausschließlich funktional als Verankerung der Handlung dienen. Eine Ausnahme allerdings bildet die Reise, die die Erzählerin mit „ihm“ nach Istanbul unternimmt.10 In der Europa und Asien verbindenden Stadt verwischen sich die Grenzen zwischen den Kontinenten – […] l’Europe comme l’Asie prenaient des contours imprécis […] – 11 und die Erzählerin stellt erfreut fest „[…] qu’il était possible de rêver ensemble, de regarder dans la même direction – la main dans la main, vouloir la même chose“12. Sowenig Europa und Asien am Bosporus in Opposition zueinander stehen, sowenig trennt die unterschiedlichen Geschlechter: „[…] la traversée nous unissait, entre Europe et Asie, dans l’un de ces villages […] nous aurions pu vivre […].“13 Die Erzählerin betont sehr bewusst die „Normalität“ der persönlichen Beziehung, indem sie dem gemeinsam genutzten Hotelzimmer mit einem „[…] lit ancien […]“ und fehlendem Anrufbeantworter den Anstrich des Altertümlichen und obendrein des sittlich Unbedenklichen verleiht: „[…] la fenêtre donnant sur le jardin abrita notre envie, enlacés nous roulions vers les rivages du soir, le village de pêcheurs et sa vie, où nous aurions abandonné la nôtre.“14
Gleichwohl gelingt es der Erzählerin in Istanbul nicht, ihre Aufmerksamkeit ungeteilt nur auf „ihn“ zu lenken. Bei der Ankunft in der Stadt am Bosporus hat sie, erotisch sensibilisiert, in seiner Begleitung mit dem Anblick von Minaretten gerechnet, schaut nun aber auch auf „[…]les coupoles des mosquées […]“15 und „[…] des dômes largement étalés […]“16, die in ihr nicht nur Erinnerungen an „sie“, sondern geradezu das sehnsüchtige Verlangen nach „[…] ses bras, son étreinte, ses mains, et, au-delà, son corps […]“17 wecken. Dass es sich dabei um einen, wie sie sagt, einer „Obsession“ ähnelnden Zustand handelt, verdeutlicht ihre Feststellung: „S’il m’avait laissée seule, j’aurais erré, je crois, de mosquée en mosquée, à sa recherche, et je serais tombée, quelque part, en extase.“18
2.2.2 Reisebewegungen
Reiseziele und Bewegungsvorlieben des geliebten Mannes und der Erzählerin
Indem die Erzählerin sich im Kontext der Schilderung der Reise nach Istanbul über ihre eigenen und die Bewegungsvorlieben des von ihr geliebten Mannes äußert, entwirft sie rudimentäre Charakterskizzen:
Il aimait les îles désertes, les endroits isolés, les rochers escarpés, les pentes abruptes, surtout l’aridité, l’escalade – il recherchait l’exploit. Moi, je préférais le large et la navigation – qu’il appelait errance – les grandes étendues, mais pas arides […]1
Eine kurze Zeit nach der Rückkehr aus Istanbul vervollständigt die Erzählerin das Bild:
Quelque temps après le retour du pays d’été, lui me faisait peur, la vie tracée qu’il m’offrait m’intimidait, m’ennuyait, je l’avais refusée, il m’avait dit on ne peut pas passer sa vie à naviguer quand j’avais dit que j’avais besoin de naviguer, et à force de ne plus le voir, je commençais à me demander s’il n’avait pas raison.2
„Sein“ Verhalten ist – aus der Sicht der Erzählerin – folglich dadurch gekennzeichnet, dass „er“ zwar durchaus abenteuerähnliche Herausforderungen sucht, sich dabei aber stets in überschaubaren, eng umgrenzten Räumen bewegt. Wenn sein Leben dementsprechend in „vorgezeichneten Bahnen“ verläuft, ist es ihrer Meinung nach risikoarm, wenig überraschungsanfällig, langweilig. Ebendies jedoch und „seine“ Mahnung „[…] on ne peut pas passer sa vie à naviguer […]“ wirken auf die freiheitshungrige, auf eine Entgrenzung ihrer Erfahrungen bedachte Erzählerin abschreckend und frustrierend, obwohl seine Worte, sobald sie „ihn“ längere Zeit nicht sieht, ihre Wirkung auf sie nicht ganz verfehlen. Wenn sie jedoch ihre Bahnen schwimmt, schweifen ihre Gedanken in die Wüste Namibias mit ihren in den südlichen Atlantik ragenden Sanddünen oder in die Gewässer zwischen Feuerland und die Antarktis, wobei sie die letztgenannte geographische Präferenz mit einem auf der Homonymie des Lexems „glaces“ beruhenden Wortspiel begründet: „[…] ah, les glaces, je les préfère en mer plutôt que dans les cœurs.“3
„[…] ce voyage si loin hors de mes frontières […]“ – die Erzählerin und ihre Geliebte
Читать дальше