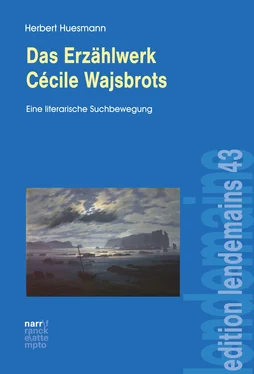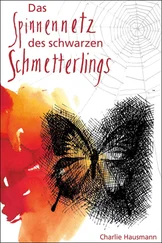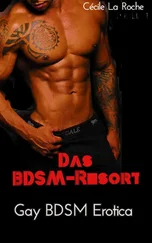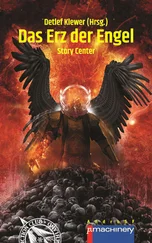[…] car les chemins détournés construisaient la route pour y parvenir, et trouver le pont-levis baissé, les lourdes portes grandes ouvertes, aucun soldat pour garder les salles, avancer avec précaution vers le cœur, portes ouvertes, aucun soldat, avancer encore et enfin la trouver elle, seule, abandonnée, prête à ce qu’elle avait toujours refusé, ignoré – comme lui – prête à prendre au sérieux ce qu’elle feignait de croire un jeu, et lui, Vincent, désemparé par l’évidence, pris au dépourvu, continuait le chemin, avançait […] la rejoignait avec la sensation, dans ses bras, d’être arrivé pour la première fois, l’unique.8
Die Bilderfolge gelangt an dieser Stelle zu einem isotopisch-konsistenten Höhepunkt. Der erinnerte, metaphorisch verfremdete Ort der Begegnung des sich liebenden Geschwisterpaars – la chambre où ils se trouvaient – entzieht sich jeglicher Vorstellung von Realität, sowohl dem geschlossenen Raum der aus der Fantasie der Erzählstimme geborenen „forteresse“ als auch der als grenzenlos gedachten Welt:
Les portes lourdes se refermaient d’un coup brutal. La forteresse était coupée du monde, comment tant de chemins comment tant de détours avaient pu y mener, et la chambre où ils se trouvaient était coupée de la forteresse coupée du monde.9
Man muss sich Vincent im Haus am Meer als einen einsamen, trauernden Menschen vorstellen, der sich verzweifelt fragt „[…] pourquoi son avion, à une semaine de distance, n’avait pas eu la même défaillance, comme ils disaient, au-dessus de l’océan, pourquoi pas le sien, si elle était restée, au lieu de lui, que penserait-elle, à sa place, quels regrets?“10
Das Treffen am Meer bahnt Hugo, der die Frage François’: „Tu l’aimais?“ für alle hörbar mit „Oui“11 beantwortet, den Weg zum Suizid.12 Die Erzählinstanz wählt für das tragische Ende einen angesichts des Ortes der Handlung im Wortsinn naheliegenden, vor allem aber eine den Gefühlen und Sehnsüchten Hugos im höchsten Maße entsprechenden Ausgang. So beginnt der letzte Abschnitt des Schlusskapitels – Presto – mit den Worten:
Hugo se releva […] il avait besoin de la mer. […] Quelle heure pouvait-il l’être, il s’en moquait, midi, une heure, deux heures, il était en retard, mais en retard pour quoi, il n’avait pas l’intention de revenir. Le soleil était haut, il entendait la rumeur de la mer et le reste – le reste n’existait pas.13
Hugo nähert sich dem Meer und befindet sich „[…] à la limite des terres et de l’océan bleu“14 – eine Formulierung, die sofort die Erinnerung an „ihre“ Augenfarbe wachruft und darüber hinaus eine gedankliche Verbindung zum Flugzeugabsturz über dem Atlantik evoziert. Hugo erinnert sich an sein letztes Telefonat und Treffen in einem Café mit „ihr“ und wirft sich vor, „sie“ nicht vor der Nähe Vincents bewahrt und von der Reise nach Brasilien zurückgehalten zu haben. Als er schließlich den Ruf „Hugo“ vernimmt, fragt er sich: „[…] était-ce elle encore, déjà?“15 Als ob er von „ihr“ gerufen würde, scheint er ihr geradezu entgegengehen zu wollen, um zumindest im Tod für immer mit „ihr“ vereint zu sein. Dabei lässt die Erzählinstanz in der Schwebe, ob er das Rufen seiner Gefährten noch wahrgenommen hat:
Hugo! Ils l’avaient repéré, enfin, il s’enfonçait dans la mer, eux étaient loin encore.16
2.1.3 Perspektivierende Zusammenfassung
Abschließend soll die Bedeutung, die der Suchbewegung der Figuren und dem wechselseitigen Verhältnis zwischen den Schauplätzen über die Ebene der „histoire“ hinaus zukommt, näher betrachtet werden.
Paris ist der Ort, an dem sich – in der in Rückblicken erfassten Hintergrundhandlung – das sich regelmäßig sonntags treffende Quartett konstituiert hat und später auflöst. Die Auflösung der Gruppe ist, wie oben ausgeführt, „ihrem“ Überdruss an den „regards de biais“1 der drei männlichen Mitglieder des Quartetts geschuldet, deren Verhalten durch ihren Lebens- und Arbeitsraum maßgeblich geprägt ist:
François als „ihr“ Ehemann scheint in seinem Antiquitätenladen durch die Beschäftigung mit „toten“ Gegenständen der Vergangenheit sowohl der Gegenwart als auch der Zukunft entrückt. Umgeben von Spiegeln, steht er in der Gefahr, die ihm begegnenden Personen nur in reflektierten Ausschnitten wahrzunehmen. Aus der Sicht Vincents ist er „[…] un sédentaire […] un sédentaire dans l’âme, incapable de changer d’avis une fois qu’il se fixait sur un objet, un lieu, une personne […]“2. Dass er der Einladung Gilles’ zu einem Treffen in seinem Haus am Meer ohne Begeisterung folgt, sie aber für notwendig hält,3 ist ein Zeichen für seine pragmatisch motivierte Einsicht in seine Lage. Der Tod seiner Frau, die ihn telefonisch aus Brasilien über ihre Scheidungsabsichten informiert hat,4 ist für ihn offensichtlich nicht mehr als der Schlussstrich unter einer ohnehin abgestorbenen Beziehung. Im Sinne Lotmans ist er eine „unbewegliche Figur“.
Der Archivar Hugo, dessen Liebe von „ihr“ nicht angemessen erwidert wird, betrachtet sich als „Archäologen, Geologen“ der Zeit, eine bildhafte Formulierung, in der sich seine Sicht der Verräumlichung von Vergangenheit, aber auch sein forschendes Suchen manifestieren. Sein „ihr“ gegebenes Versprechen „Je serai ta mémoire“ löst er auf „seine“ Art ein, indem er „ihr“ im (Frei)tod bis auf den Grund des Meeres folgt, um so einerseits auf ihr Sterben und andererseits auf seine Liebe zu ihr aufmerksam zu machen. Seine Erinnerung an „sie“ findet ihren Ausdruck in seiner symbolischen Bemühung um räumliche Nähe im Tode. Aufgrund der Radikalität seines Handelns, seines selbstbestimmten Überschreitens der Grenze zwischen Leben und Tod ist er eine im Lotman’schen Sinn „bewegliche Figur“.
Vincent, der als geschäftlich Reisender und somit von vornherein als Bewegungs figur vorgestellt wird, „umwirbt“ seine Schwester zu einem frühen Zeitpunkt mit der Einladung, ihn auf Reisen zu begleiten. „Sie“ möchte nicht von ihm verlassen werden, doch
[…] il était parti, Vincent, le premier, la mort dans l’âme, le voyage dans
les yeux.
Vers où? Les continents ne pouvaient pas l’assouvir, il partait pour le che-
min le plus long, la recherche de ce qu’il avait, la recherche de ce qu’il
fuyait.“5
Vincent wird zu Beginn des Romans von der Erzählinstanz kryptisch als eine suchende Person beschrieben, die, wie wir durch sein Gespräch mit Hugo erfahren, das, was sie sucht, nämlich die Liebe zur Schwester, bereits besitzt, aber davor zunächst zu fliehen scheint. Während seiner und ihrer Reise von Paris nach Brasilien, die Gilles als Reise „au bout du monde“6 betrachtet, kommt es erst unter dem Einfluss der oben geschilderten Bedingungen vor Ort zum Tabubruch. Dadurch entstehen zwei durch den Atlantik und tiefe sozio-kulturelle Unterschiede getrennte „disjunkte Räume“ im Sinne Lotmans. Vincent und seine Schwester haben somit im wörtlichen und übertragenen Sinn „Grenzen“ überschritten und sind dementsprechend als „bewegliche Figuren“ zu betrachten. Auf ihre Grenzüberschreitung folgt die Katastrophe des Flugzeugabsturzes über dem Atlantik, bei dem die Schwester ihr Leben lässt. Die „doppelte Grenzüberschreitung“ des Geschwisterpaars bildet den „Sujetkern“ des Romans. Auf Hugo wirkt Vincents Offenlegung des inzestuösen Verhältnisses zu seiner Schwester wie eine reinigende Katharsis, die in der von Hugo gesuchten „Vereinigung“ mit ihr im Wasser des Atlantik symbolisch vollzogen wird.
Der Theaterregisseur Gilles, der „sie“ zwar kennen lernt, sich von ihrer blendenden und im Spiegel reflektierten Schönheit beeindruckt zeigt und vergeblich versucht, „sie“ für ein Theaterprojekt zu gewinnen, scheint als Nichtmitglied des (ursprünglichen) Quartetts zwar nur eine Randfigur zu sein. Aufgrund seines Berufes ist er jedoch prädestiniert, zu dem Wiedersehenstreffen von Paris aus an einen Ort einzuladen, der sich durch die Nähe und Distanz zum Atlantik gleichermaßen auszeichnet und so zwischen „le large“, der Sehnsucht nach Weite und Entgrenzung des Lebens einerseits und der Gebundenheit an den Ort, vertraute Verhältnisse und Konventionen andererseits vermittelt. Er wird als Initiator des Treffens am Meer zum Regisseur einer Rekonstruktion der Suchbewegungen, die erst dort transparent und gleichzeitig beendet werden.
Читать дальше