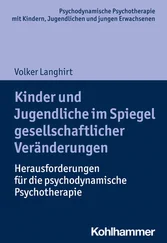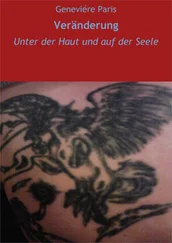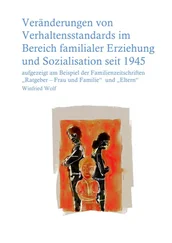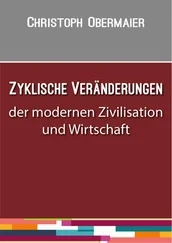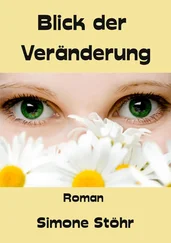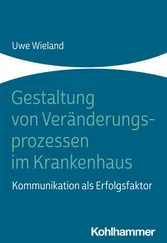Thomä, Helmut/Kächele, Horst (2006). Psychoanalytische Therapie: Grundlagen. 3. überarbeitete und aktualisierte Aufl. Berlin/Heidelberg: Springer.
Voutilainen, Liisa/Peräkylä, Anssi/Ruusuvuori, Joanna (2011). Therapeutic change in interaction: Conversation analysis of a transforming sequence. Psychotherapy Research 21:3, 348–365.
Voutilainen, Liisa/Peräkylä, Anssi (2016). Interactional Practices of Psychotherapy. In: O’Reilly, Michelle/Lester, Jessica Nina (Hrsg.) The Palgrave Handbook of Adult Mental Health. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 540–557.
Voutilainen, Liisa/Rossano, Federica/Peräkylä, Anssi (2018). Conversation analysis and psychotherapeutic change. In: Pekarek Doehler, Simona/Wagner, Johannes/González-Martínez, Esther (Hrsg.) Documenting Change Across Time: Longitudinal Studies on the Organization of Social Interaction. Palgrave Macmillan, 225–254.
Watson, Jeanne C./McMullen, Evelyn J. (2016). Change Process Research in Psychotherapy. In: Olson, Karin/Young, Richard A./Schultz, Izabela Z. (Hrsg.) Handbook of Qualitative Health Research for Evidence-Based Practice. Berlin: Springer, 507–525.
Weiste, Elina/Peräkylä, Anssi (2013). A Comparative Conversation Analytic Study of Formulations in Psychoanalysis and Cognitive Psychotherapy. Research on Language and Social Interaction 46:4, 299–321.
Weiste, Elina/Peräkylä, Anssi (2015). Therapeutic discourse. In: Tracy, Karen (Hrsg.) The International Encyclopedia of Language and Social Interaction. Hoboken: Wiley, 1–10.
Whitworth, Laura/Kimsey-House, Henry/Kimsey-House, Karen/Sandahl, Phillip (1998). Co-active coaching: New Skills for Coaching People toward Success in Work and Life. Palo Alto: Davis-Black Publishing.
Wöller, Wolfgang/Kruse, Johannes/Albus, Christian (2009). Von der Klärung zur Deutung. In: Wöller, Wolfgang/Kruse, Johannes (Hrsg.) Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: Basisbuch und Praxisleitfaden. 2. überarbeitete und erweiterte Aufl. Stuttgart: Schattauer, 141–153.
Zum Begriff sprachlichen Helfens und seinen Implikationen für Veränderung
Ina Pick & Claudio Scarvaglieri
Abstract:This article develops a concept of helping in and through language and analyzes transcripts of helping conversations from a linguistic perspective. We understand helping in and through language as taking on (parts of) actions in the pursuit of a common goal. Such helping in and through language transpires as a communicative pre-structuring of alternatives of thinking and/or acting. Such a pre-structuring can be performed in weak (formulating or activating of knowledge), intermediate (evaluating alternatives) or strong (explicit weighting of alternatives) ways. Our analyses show that in general the ‘action complex’ of helping in and through language can be performed within different institutional constellations. However, depending on the overarching institutional constellation in which the action complex is embedded, we find varying degrees of pre-structuring alternatives (from weak to strong) as well as differences regarding the pre-structuring of alternatives of thinking versus alternatives of acting in relation to the different settings. We consider helping in and through language endemically geared towards change. Based on our analyzes, change is discussed here in two dimensions: first, change relates to the result of the action process in practice supported by the helping (inter-)actions. Second, change relates to a mental process that is initiated by helping in and through language in the person seeking help. This process is initiated before change becomes evident in practice on the action level.
Keywords:Helping in and through language; communicative action; discourse analysis; change as process; change as outcome
1. Helfendes Handeln – Eine begriffliche Annäherung
Das Konzept des Helfens ist in einer Reihe professionalisierter gesellschaftlicher Domänen – etwa Schule, Bildung, Beratung, Soziale Arbeit – von Bedeutung und gibt entsprechend auch den helfenden Berufen bzw. helfenden Professionen ihren Namen, ohne dass das spezifisch ‚Helfende‘ der so bezeichneten professionalisierten Tätigkeiten präzise bestimmt wäre. Mit diesem Artikel möchten wir zu einer Präzisierung des Begriffs institutionalisierten sprachlichen Helfens beitragen. Dazu gehen wir von einem handlungstheoretischen, prozessorientierten und interaktionalen Verständnis alltäglichen Helfens aus, das wir datenbasiert zu einer Bestimmung von sprachlichem institutionalisiertem Helfen weiterentwickeln.
Im Alltag wird ethnokategorial in Situationen von Helfen gesprochen, in denen Aktant*innen bestimmte Handlungen oder Zwischenschritte von Handlungen abgenommen werden. Dies muss nicht immer sprachlich geschehen, sondern kann auch durch nichtsprachliches Handeln vollzogen werden. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn ein Kind seine Schuhe zwar anziehen, sie aber noch nicht selbst binden kann, wenn eine verunfallte Person nicht aufstehen und sich in Sicherheit bringen kann oder wenn jemand krankheits- oder altersbedingt nicht in der Lage ist, Nahrung eigenständig zu sich zu nehmen. In all diesen Fällen übernimmt eine helfende Person eine der Teilhandlungen, bindet also etwa den Schuh zu, zieht die verunfallte Person zur Seite, führt den Löffel zum Mund. Dabei können, je nach Grad der Handlungseinschränkung, dem Hilfebedürftigen mehr oder weniger Handlungen abgenommen werden: einem Kind, das gerade dabei ist zu lernen, wie man eine Schleife bindet, muss ggf. nur beim letzten Schritt, dem Zuziehen der beiden Schlaufen, geholfen werden, während einem anderen Kind alle Teilhandlungen des Schuhebindens abgenommen werden müssen.
Zudem wird auch dann von Helfen gesprochen, wenn die hilfeempfangende Person an sich in der Lage wäre, die Handlungen selbst durchzuführen – wie etwa bei der Hilfe beim Umzug –, man sie jedoch aufgrund von Menge oder Komplexität der auszuführenden Handlungen entlastet, so dass diese schneller erledigt werden können oder physisch weniger belastend sind. Im Alltag erfolgt Helfen vielfach ohne unmittelbare Gegenleistung; dies ist besonders der Fall, wenn Eltern kleinen Kindern helfen – eine Art Urkonstellation des Helfens –, aber auch bei der sog. „Ersten Hilfe“ bei Unfallopfern, bei nachbarschaftlicher Hilfe u.ä. In modernen Gesellschaften findet sich das Helfen auch als institutionalisierte und organisierte Handlungsform, die in unterschiedlichen gesellschaftlichen Konstellationen mit verschiedenen Zwecksetzungen und für je spezifische Problemlagen durchgeführt wird und der dann auch Gegenleistungen eingeschrieben sind (monetäre Vergütungen, das Erreichen von institutionellen Zwecken, das Aufrechterhalten gesamtgesellschaftlicher Ziele etc.) (Luhmann 1975; Tomasello 2010: 46f.; 74; Oevermann 2013).
Dem Helfen liegt damit eine asymmetrische Grundkonstellation zugrunde (vgl. bereits Rehbein 1977: 323; Kallmeyer 2000: 241) – während die Hilfeempfangenden mit der Ausführung der Teil-Handlungen momentan oder generell überlastet sind, ist die helfende Person in der Lage, diese Handlungen durchzuführen. Helfen setzt entsprechend ein spezifisches Wissen bzw. Können auf Seite der Helfenden voraus. Die genannten Beispiele machen auch deutlich, dass Helfen unterschiedlich situiert sein kann und unterschiedliche Funktionen übernehmen kann: es kann im Sinne des Vormachens dazu dienen, die hilfeempfangende Person in die Lage zu versetzen, die entsprechenden Handlungen selbst durchzuführen (im Sinne der ‘Hilfe zur Selbsthilfe’, diskutiert u.a. bei Oevermann 2013), oder es kann als vollständiger oder teilweiser Ersatz einer Handlungsfähigkeit dienen, die zumindest kurz- oder mittelfristig nicht wiedergewonnen werden kann (etwa bei verunfallten oder dauerhaft erkrankten Personen). Wesentlich für ein gelingendes Helfen ist, dass helfende und hilfeempfangende Person das gleiche Ziel verfolgen bzw. eine geteilte Zielvorstellung diskursiv entwickeln (zum sprachlichen Helfen s.u. Kap. 2). Die Vorstellung über die mit dem Helfen anzustrebende Veränderung des gegebenen, in bestimmter Hinsicht als defizitär empfundenen Zustands kann entweder explizit ausgehandelt werden oder für bestimmte Situationen so typisch sein, dass sie von beiden Seiten vorausgesetzt wird. Beim Schuhebinden etwa ist das Ergebnis aufgrund von Handlungsroutinen vorhersehbar und muss nicht ausgehandelt werden, bei komplexeren Problemlagen gibt es dagegen meist unterschiedliche mögliche Ergebnisse, die im Hilfeprozess abgewogen werden müssen. Wie u.a. die hier analysierten Daten zeigen (u. Kap. 3), basiert Helfen auf der genuin menschlichen Fähigkeit der Perspektivenübernahme, also des zeitweisen Hineinversetzens in andere Handlungsrollen bei geteilter Aufmerksamkeit (Tomasello 2010: 64).
Читать дальше